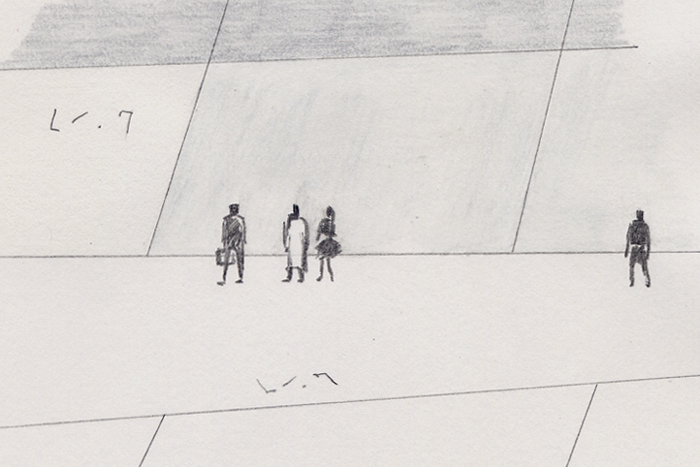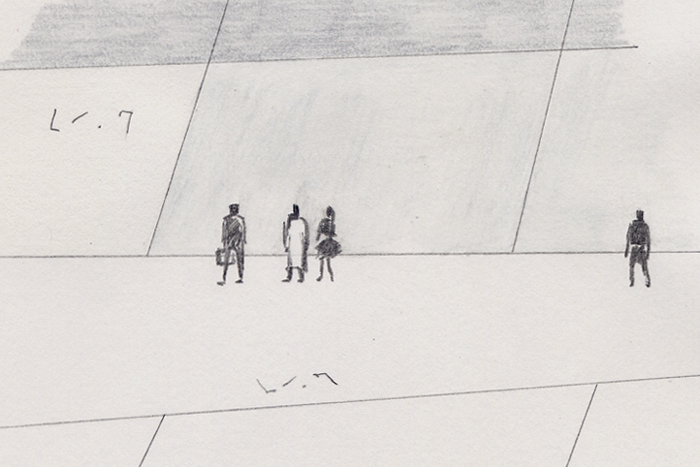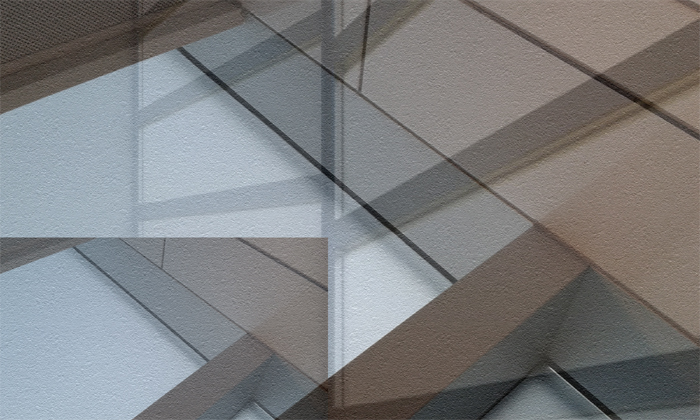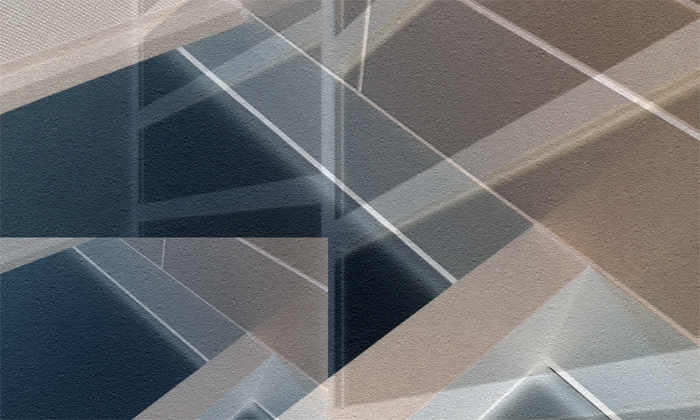|
|
L /. 7
"Bis du versuchst,
keiner zu sein,
niemals und niemand,
nur das allein."
(Graffito aus der Location "Zwischenfall", die abgerissen wurde)
1999. Tain will nach Hause ... doch: wo ist das?
"L /. 7" - Tain hatte sich angewöhnt, diese Bezeichnung zu verwenden, wenn er von der irdischen Welt sprach, aus der er kam. Es war der Bestimmungsort der Transporteinheit in Stellwerk, die für Tain vorgesehen war. Der Schriftzug "L /. 7" erschien auf einer grauen, mehrfach geknickten Wand hinter der Plattform. Durch die große gläserne Halle liefen in schwindelerregender Höhe zwei Bahnlinien, die zu den Terminals führten. Unter dem weißen Himmel hörte man ein Klingen wie von tönernen Glocken.
Die Metropole Stellwerk besaß nicht den einzigen Raumflughafen auf Saroud, aber den mit Abstand größten. Interstellare Verbindungen gab es nur zwischen Saroud und L /. 7, aber viele weitere zu Außenstationen. Daro Staale hatte in der von Stellwerk aus betriebenen Forschung eine leitende Position inne. Tain hatte seit seiner Ankunft auf Saroud geplant, für das Team um Staale zu arbeiten. In den Jahren danach war es ihm gelungen, diesen Plan zu verwirklichen. Als ihm angeboten wurde, im Rahmen seiner Tätigkeit nach L /. 7 zurückzukehren, hatte er unter anderem deshalb eingewilligt, weil er davon ausging, daß es seine Karriere voranbringen würde. Es gab noch weitere Gründe, aber mit denen mochte Tain sich kaum befassen.
Ehe Tain nach L /. 7 aufbrach - und in der Transporteinheit den Androiden Sel Veey kennenlernte -, war alles nach Plan gelaufen. Mit entspannter Stimmung, ohne Aufregung hatte Tain der Rückkehr nach L /. 7 entgegengesehen, seiner früheren Heimat. Erst am Nachmittag vor seiner Abreise hatte sich etwas verändert. Tain hatte in Kleidern in seinem Bett gelegen und nach draußen in die neblige Luft geschaut. Das Schlafzimmer in seiner Wohnung hatte ein Fenster, das die gesamte Außenwand einnahm und von schwarzen Streben durchbrochen war. Dahinter öffnete sich ein Abhang in weite Ferne, unter Rauhreif erstarrt. Es wurde langsam dunkler, schleichend, als wenn man das Licht herunterdrehte.
Tain wußte nicht zu sagen, weshalb, aber er hatte das Gefühl, hier nicht liegen und sich ausruhen zu dürfen.
Eine ungekannte Wärme in seinem Inneren hielt ihn hier fest und gab ihm die Gewißheit, daß alles, was geschehen konnte oder was er tun konnte, auf ein einziges, vorbestimmtes, aber unbekanntes Ziel hinauslaufen mußte. Die Ahnung griff nach ihm, nicht mehr selbst entscheiden zu können, wohin er sich wandte. Und er lag hier und versäumte die Gelegenheit zur Flucht.
"Ich will diese Ruhe nicht", dachte er. "Wenn ich mich gehen lasse, nehmen andere mich in Besitz."
Tain wußte nicht mehr, was ihm wichtiger war: Sicherheit oder Freiheit. Und er sagte sich, daß im Grunde beides fehlte, wenn er von den Lebenserhaltungssystemen in einer engen Transporteinheit abhängig sein würde, die er dazu noch mit einundzwanzig Personen teilen mußte. Der Android, der den Reisenden zu Diensten sein sollte, galt übrigens nicht als Person und wurde deshalb nicht mitgezählt. Tain war neugierig auf das Kunstwesen, über dessen verwirrende Menschenähnlichkeit viel gesprochen wurde.
Mit Schaudern dachte Tain an nikotinhaltige Kaugummis. Die würde es reichlich geben an Bord - aber keine einzige Zigarette.
"Was zieht mich nur wieder nach L /. 7? Warum mute ich mir das zu, siebzehn Tage ohne Zigaretten?" fragte er sich ein ums andere Mal - und fand keine Antwort.
|
|
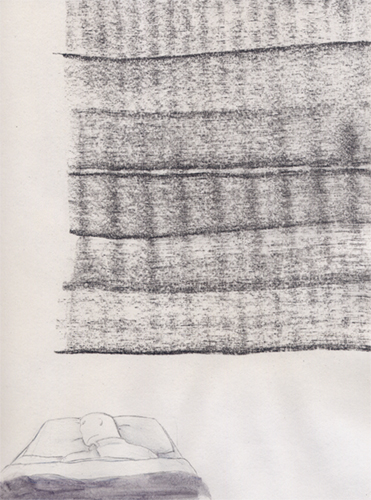
|
|

|
|
Leise kam Rega Mansfeld ins Zimmer, vorsichtig schauend, ob Tain schlief.
"Irgendwas ist mit dir", sagte Rega, "aber ich weiß nicht, was."
Tain schwieg und rührte sich nicht.
"Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, wenn du mitkommst nach L /. 7", meinte Rega zögernd.
Tain langte nach seiner Zigarettenschachtel und fragte betont beiläufig:
"Wie kommst du darauf?"
"Ich bin mir nicht sicher, ob du das wirklich willst."
"Weshalb sollte ich das nicht wollen?"
"Ich weiß es nicht ..."
Tain hatte es nicht gern, wenn Rega viel über ihn nachdachte; darauf wies er ihn auch noch einmal hin, als sie am nächsten Morgen auf dem Weg zum Raumflughafen Stellwerk in der Bahn saßen.
"Diese Fähre kann man nicht so anonym besteigen wie einen Zug", erklärte Tain. "Wir sind aneinander gebunden, weil jeder eine bestimmte Aufgabe hat. Und wir müssen miteinander auskommen. Deshalb ist es besonders wichtig, daß jeder Einzelne die Gelegenheit hat, sich abzugrenzen."
Der silberweiße Zug fuhr an einem künstlichen Wall entlang, der bedeckt war mit merkwürdig geformten elektronischen Anlagen. Man konnte sich vorstellen, daß es sich um lauter Androiden handelte, die sich hier trafen und die vorbeirauschenden Waggons beobachteten.
"Die Transporteinheit wird doch von Riann Dawyne kommandiert?" fragte Tain nach.
Rega schüttelte den Kopf.
"Von Daro Staale", gab er Auskunft.
"Riann will gar nicht mehr nach Lanwer?"
"Nach L /. 7 schon, aber nicht nach Lanwer."
"Wo will die denn sonst hin?"
"Irgendwas in der Antarktis, glaube ich."
Lanwer - ein Stützpunkt von Saroud auf L /. 7 - war Tains zukünftiger Einsatzort. Rega sollte ebenfalls dort arbeiten, jedoch nur für ein einzelnes Forschungsprojekt und damit wesentlich kürzer als Tain.
"Eigentlich bin ich doch gar nicht so weit weg von der Welt, aus der ich gekommen bin", überlegte Tain. "Im Grunde trennen mich doch nur siebzehn Tage von L /. 7. Siebzehn Tage dauert es, bis man dort ist."
"Wir sind Lichtjahre entfernt."
"Lichtjahre entfernt ... das haben wir früher immer gesagt, wenn wir gemeint haben, etwas kann überhaupt nicht verglichen werden mit etwas anderem."
"Das, was wir hier haben, auf Saroud - ist im Grunde mehr eine Parallelwelt als etwas wirklich anderes als L /. 7."
"Findest du."
"Sogar die Jahre sind hier fast so lang wie Erdenjahre", beschrieb Rega. "Es gibt Jahreszeiten, es gibt Tag und Nacht, die Uhren und die Zeiteinteilung sind fast so wie auf L /. 7 ... Irgendwann sind Menschen auf ihnen selbst sehr ähnliche Wesen getroffen, die Vorfahren der meisten hier ... Im Grunde waren es auch Menschen, sonst hätten sie sich nicht miteinander kreuzen können. Wie eine solche Parallelentwicklung stattfinden konnte, kann bis heute niemand erklären."
"Die Leute hier sollen nur überlebt haben, weil sie sich vermischt haben mit den Menschen, die sie hergeholt haben", ergänzte Tain. "Hier wären sonst alle ausgestorben."
"Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Austausch, auch Austausch von Kultur, Austausch von Arten ..."
"Ja, sonst hätten wir hier weder Kaffee noch Kippen."
"Hier wurde es immer irdischer, ohne daß die Irdischen das mitbekommen haben."
"Haben sie es wirklich nicht mitbekommen?" fragte Tain.
"Man kann sich auch an etwas gewöhnen, ohne zu wissen, um was es sich handelt", meinte Rega. "Was wir auf Saroud inzwischen sind, weiß niemand mehr so genau. Es ist kaum noch feststellbar, und eigentlich sind wir alle ein und dasselbe. Die Unterschiede, die es einmal gab, sind längst bedeutungslos geworden."
"Unterschiede ... was haben die in meiner Teenagerzeit für eine Bedeutung gehabt ...", erinnerte sich Tain. "Damals war ich noch nicht hier, sondern in L /. 7. 'Was hast du an?' - 'Was für Musik hörst du?' - 'In welche Läden gehst du?' - 'Mit welchen Leuten redest du?' Danach wurde alles beurteilt."
"Und wenn doch jemand auf L /. 7 etwas von Saroud erfahren hat?" wurde Rega nachdenklich. "Wie war das mit deinen Eltern? Dein Vater hat doch eine von hier geheiratet."
"Darüber wurde bei uns kaum geredet. 'Saroud' war für mich eher etwas Abstraktes, ich wußte nur, das ist weit weg, aber kaum mehr. Bisher ist es, soweit ich das mitbekommen habe, um das Thema immer ruhig geblieben. Es gab keine Sensationsmeldungen und dergleichen. Dabei ist alles medienwirksam, was mit fremden Welten zusammenhängt. Es könnte also durchaus noch einen Medienwirbel geben, bis sich dann, Jahre später, wieder alle daran gewöhnt haben."
"Warum willst du zurück nach L /. 7?" erkundigte sich Rega. "Ich meine, unabhängig von deinen beruflichen Aufgaben."
"Weil ich schon so lange weg bin", gab Tain unwillig zur Antwort. "Und du fragst wieder einmal viel zu viel."
- - -
Rega kamen diese Gespräche mit Tain wieder in den Sinn, als Leen in der Küche der Transporteinheit von ihm wissen wollte, ob ihm an Tain schon etwas Ungewohntes, Befremdendes aufgefallen war, bevor sie Stellwerk verließen und bevor Tain mit Sel Veey aneinandergeraten war.
"Ich hatte so eine Vorahnung", erzählte Rega, "ich weiß nicht, was mich darauf gebracht hat; vielleicht war es diese Teilnahmslosigkeit, dieser Wunsch, alleingelassen zu werden. Tain schien es nicht ertragen zu können, wenn sich jemand für ihn interessierte. Er wirkte dann recht abwehrend und ungehalten."
"War das erst kurz vor dieser Reise so?"
"Wenn ich nachdenke ... das hat sich so allmählich eingeschlichen, daß man es kaum bemerkt hat, am allerwenigsten vermutlich Tain selbst. Er wirkte immer mehr in sich gekehrt und irgendwie abwesend."
"Hattest du den Eindruck, er hat sich vor irgendetwas gefürchtet?"
"Furcht hat es für Tain nie gegeben", war Rega überzeugt. "Er hat immer alles nur von der technischen Seite betrachtet, auch seine Aufgaben in L /. 7."
"Tain wird lange nicht nach L /. 7 kommen", sagte Leen. "Es hat sich in sehr kurzer Zeit sehr viel geändert."
"Ich kann das nicht fassen. Tain war immer berechenbar, seine Voraussagen stimmten zuverlässig, er hatte sich stets in der Gewalt, er konnte wirklich über sein Schicksal selbst entscheiden."
"Tain war so selbständig, daß es ihn fast umgebracht hat."
"Wenn ihn das hier nicht erwischt hätte, hätte er bis in alle Ewigkeit so weitermachen können."
"Bist du dir da sicher?"
Rega seufzte.
"Hast recht", meinte er, "irgendwann braucht doch jeder mal die Unterstützung von anderen."
"Wenn du mich fragst, es gibt keine Zeit im Leben, in der man nicht auf andere angewiesen ist, in irgendeiner Form. Es kommt nur darauf an, ob es einem bewußt wird ..."
"Tain wäre ohne die Initiative anderer gar nicht erst nach Saroud gekommen", führte Rega sich vor Augen. "Schließlich kann man solche Reisen nicht einfach so buchen."
"Mein früherer Mentor Thara ist mit Tain verwandt", erzählte Leen. "Er ist der Halbbruder von Tains Mutter Ida. Im irdischen Jahr 1991 sind Thara und ich auf L /. 7 gewesen, wo Tain damals noch lebte. Thara nahm mich mit zu Tain. Er wollte wissen, was aus ihm geworden war.
Er hatte ihn zuletzt kurz nach Idas Tod gesehen und danach den Kontakt verloren. Tain wohnte alleine in dem Haus der Familie. Sein Vater Theodore hat es ihm überlassen, als er fortging."
"Hatte er sonst niemanden mehr?"
"Tain ist Einzelkind. Ida ist 1968 von Saroud nach L /. 7 gezogen und hat Theodore geheiratet. Sie haben gebaut, einen Bungalow im Spessart. Tain kam 1971 zur Welt. Er war fünfzehn, als Ida auf tragische Weise umgekommen ist. Es hing mit einem Streit zwischen Ida und Theodore zusammen. Um was es ging, weiß ich nicht. Ida lief irgendwann in ihrer Aufregung durch die Terrassentür nach draußen. Es war unerwartet sehr kalt geworden, an die zehn Grad unter null. Ida wurde in der Kälte ohnmächtig und erfror. Theodore ließ sich daraufhin versetzen und zog weit weg."
"Er hat seinen fünfzehnjährigen Sohn alleine gelassen?"
"Theodore dachte wohl, Tain ist alt genug", vermutete Leen. "Für Unterschriften und dergleichen stand er seinem Sohn noch zur Verfügung, und offiziell hatte er auch noch einen Wohnsitz in dem Haus, damit das Jugendamt keine Fragen stellte."
"Sein eigener Sohn war ihm wohl völlig gleichgültig?"
"Thara und ich haben Tain nicht gefragt, was das mit ihm gemacht hat, um nichts aufzuwühlen. Wir haben ihn nur gefragt, ob er mit uns kommen wollte. Er hat ohne langes Überlegen unser Angebot angenommen. Bis heute kann niemand sagen, ob Tain wirklich nach Saroud wollte oder ob es einfach nur eine Flucht war."
"Konntet ihr denn nie mit ihm darüber sprechen?"
"Irgendwann, später, haben wir es versucht - mehrmals -, aber Tain hat es immer abgewehrt. Er hat gemeint, daß es damals ein Arrangement war zwischen ihm und Theodore, und daß das für ihn so in Ordnung war.
Tain hat betont, daß sein Vater ihn nicht im Stich gelassen hätte. Es entstand der Eindruck, daß Tain seinen Vater nicht einmal vermißt hat. Ich vermute, Tain betrachtet Trauer und Leiden als Fehlleistungen. Und Fehler oder Schwächen läßt er sich selbst niemals durchgehen."
"Mir ist von Anfang an sein Ehrgeiz aufgefallen."
"Tain kann sich nichts verzeihen, was seinen Ansprüchen an sich selbst im Wege steht."
"Dementsprechend sieht seine Karriere aus", meinte Rega. "In Stellwerk ist Tain schon während des Studiums einer von Staales wichtigsten Mitarbeitern geworden."
"Mir kommt es vor, als wenn er sich selbst nie genug ist."
"Dann müßte es ihm doch sehr schlecht gehen", folgerte Rega.
"So ist es", bestätigte Leen.
"Tain hat auf mich viele Jahre lang recht sorglos gewirkt", erinnerte sich Rega. "Er hat Ehrgeiz gezeigt, aber zugleich war er auch darauf bedacht, seine Erfolge so wirken zu lassen, als hätte er sie ohne besondere Anstrengung erreicht. Und er hat - wenn man vom Beruflichen absieht - auch ein recht lockeres Leben geführt ..."
"Siddralein", meldete sich Ginet, "kannst du mal aufhören, mit dem Flaschenboden auf dem Tisch herumzumalen?"
"Ich bin nervös", erklärte Siddra. "Und ich werde erleichtert sein, wenn wir das alles morgen an Luce abgeben können. Seit heute sieht es im Lager echt traurig aus. Und richtig auffüllen können wir erst in Lanwer. Bis dahin laufen wir auf papierdünnem Eis. Es darf einfach nichts mehr dazukommen."
Staale erschien und goß sich Kaffee ein.
"Darf ich bleiben?" fragte er. "Oder störe ich?"
"Du störst nicht", meinte Leen. "Setz' dich zu uns."
"Ich habe nicht viel Zeit, aber ... es gibt etwas Wichtiges zu besprechen."
"Es ist wegen Tain", nahm Leen vorweg.
"Tain wird von Luce aus zurückgebracht nach Saroud, wie ihr wißt", begann Staale. "Wenn wir ihn für den Rest des Weges mitnehmen würden nach L /. 7, würde er dort nicht lebend ankommen."
"In der Nähe von Stellwerk ist dieses Institut in SalaRien", ergänzte Rega. "Mit denen ist ausgemacht, daß Tain dorthin soll. Und Sel Veey und ich begleiten ihn."
"Es gibt nur noch die Frage, ob du auch in Luce aussteigst", sagte Staale zu Leen.
"Wie lange sind wir denn in Luce?" fragte Leen. "Nur, damit ich es rechtzeitig wieder an Bord schaffe."
"Ich meine, daß du mitgehst nach SalaRien."
"Nach SalaRien? Ich?"
Staale nickte.
"Wer bleibt denn dann hier noch übrig?" wandte Leen ein. "Ist das etwa so, daß die in SalaRien keine Leute haben?"
"Die haben Leute, das ist es nicht", erklärte Staale. "Es geht um dich selbst."
"Tain verbindet mit mir ein alptraumhaftes Erlebnis, und ich will nicht, daß er immer wieder daran erinnert wird."
"Du hast gesagt, daß ihm noch sehr viel mehr Alptraumhaftes passieren wird. Du hast gesagt, nach dem jetzigen Stand der Dinge war das erst der Anfang."
Leen schwieg.
"Ohne deine Wachsamkeit wäre Tain nicht mehr unter uns", gab Staale zu bedenken. "Außerdem bist du an der Programmierung von Sel Veey beteiligt. Das könnte wichtig werden."
Leen blickte regungslos auf die Tischplatte.
"Immerhin, dir bleibt noch etwas Zeit, um dich zu entscheiden", sagte Staale und stand auf, den Kaffeebecher in der Hand.
Ginet nahm Siddra die Sprudelflasche weg und trank sie aus.
"Ach - Leen, was hatte das eigentlich vorhin mit dem Haß zu bedeuten?" fragte Siddra. "Aus welchem Grund sollte Tain sich selbst hassen?"
"Tain empfindet es als erniedrigend, sich von anderen helfen zu lassen", meinte Leen. "Und er macht es sich zum Vorwurf, wenn er nicht jederzeit die Kontrolle hat über sich und sein Schicksal."
"Niemand hat immer die Kontrolle. Warum sollte Tain sich - oder irgendwen - deshalb hassen?"
"Tain hat kein gutes Verhältnis zu sich selber. Das kann zu Konflikten führen und auch zu Haß."
- - -
Tain stand am Balkongeländer und zog an seiner Zigarette. Er blickte tief hinunter auf weites Brachland. Die hellen, strohigen Graspflanzen waren mit feinem Schnee bedeckt. Blaßblau erhoben sich die Umrisse des Stadtteils Birkwald im ersten Morgengrauen. Die Straßenzüge säumten Lichterreihen.
Tain ließ die Asche in die Tiefe fallen, an den darunterliegenden Balkongeländern entlang.
"Willst du zurück nach Birkwald?" fragte Casyle Sar, ein Mädchen im dunkelgrauen Kleid, das mit einer verzinkten Kanne die winterharten Blumen in den Balkonkästen goß. "Du wohnst da doch?"
"In Birkwald ist meine Wohnung", gab Tain zur Antwort, "aber ich will nach Lanwer, das ist in L /. 7."
"Du willst also immer noch weg von Saroud."
"'türlich", bestätigte Tain und nahm einen tiefen Zug. "Ich - will - weg - von Saroud, weg aus diesem ... Gefängnis."
"Was meinst du denn mit 'Gefängnis'?"
"Das hier."
"Du meinst das Institut, wo wir hier sind, in SalaRien."
"Wo ich nie hinwollte."
"Warum bist du dann hier?"
"Irgendwelche Leute waren der Meinung, daß ich es nicht bis L /. 7 schaffe", erzählte Tain. "Wir waren schon auf dem Weg dorthin. Und dann waren diese Leute irgendwann der Meinung, ich sollte umkehren. Und sie haben mich hierher gebracht."
"Das habe ich gehört, daß du auf einer Zwischenstation namens Luce aus der Transporteinheit aussteigen mußtest und von dort nach SalaRien gekommen bist. Warum eigentlich hierher und nicht in deine Wohnung?"
"Das ist doch dieser ganze Irrsinn ... die wollen mir was einreden ..."
"Eigentlich ist das doch unlogisch - Luce soll schon recht nah an L /. 7 sein, wäre es da nicht besser gewesen, dich nach L /. 7 zu bringen?"
"Rega hat gesagt, an Bord gab es nicht die Ausstattung wie auf Luce, und bis L /. 7 wäre ich nicht gekommen."
"Haben die dir nie erklärt, was mit dir los ist?"
"Ich will das nicht wissen, weil ich denen nicht glaube."
"Warum glaubst du denen nicht?"
"Ich wüßte nicht, warum ich solchen Leuten vertrauen sollte."
"Auch Leen nicht?"
"Geh' mir weg mit Leen", sagte Tain, hektisch rauchend. "Dem am allerwenigsten."
"Hat er was gegen dich?"
"Der lügt doch noch am meisten von allen."
"Was findet hier eigentlich statt, Tag für Tag?"
"Was meinst du denn jetzt?"
"Jeden Tag gehen mehrere Leute in dein Zimmer, auch dieser Android ist dabei, und ich frage mich, was da los ist."
"Mir sagt niemand die Wahrheit, also brauche ich niemanden zu fragen."
"Warum bist du so sicher, daß dir nicht die Wahrheit gesagt wird?"
"Das ist doch dieser ganze Irrsinn ... da stimmt doch nichts."
Tain steckte sich die nächste Zigarette an. Ihm war, als hörte er das Frühgeläut aus der alten Heimat in der eisigen Luft. Dabei war es wohl nur ein Signal an der nahegelegenen Bahnstrecke.
"Wie ist das für dich, daß du schon unterwegs warst nach L /. 7 und dann doch umkehren mußtest?" wollte Casyle wissen.
"Wie soll das sein?" wurde Tain ungeduldig. "Ich will hier weg, wie und wohin auch immer."
Als Tain erneut vom Balkon aschte, zeigte Casyle auf den Standascher in einer Ecke des Balkons.
"Hauptsache, es hat alles seine Ordung", sagte Tain dazu.
Casyle ging mit ihrer Kanne durch eine Gittertür auf den Nachbarbalkon. Tain fühlte eine Leere in sich, so unendlich wie die Weite des Himmels. Ihm war, als wenn er etwas Wichtiges vergessen hatte, und er warf sich vor, es vergessen zu haben.
Die Balkontür öffnete sich. Leen stellte sich einen Schritt von Tain entfernt ans Geländer. Tain ging nicht fort, wie er es sonst getan hatte. Er betrachtete das kalkblasse Geschöpf mit den ausrasierten weißblonden Haaren, das in einen schweren grauen Mantel gehüllt dastand und ein unbewegtes Gesicht aufsetzte. Leen schaute Tain nicht an; er verhielt sich, als sei sonst niemand da.
"Was willst du von mir?" forschte Tain.
"Was denkst du?" fragte Leen zurück.
In seiner Stimme war nichts als gelassene Höflichkeit.
"Du lebst an mir deine Machtgier aus", warf Tain ihm vor. "Du benutzt mich für dein Ego."
"Du wirst angegriffen, das steht außer Frage."
"Und es gibt dir was."
"Es bringt mich in einen Konflikt", verdeutlichte Leen. "Ich kann dir nicht helfen, ohne dir zu schaden."
"Dann laß' es doch einfach sein."
"Damit schade ich dir auch. Egal, was ich tue, ich schade dir in jedem Fall. Ich bin gezwungen, Prioritäten zu setzen."
"Und was sind das für Prioritäten?"
"Ich will, daß du überlebst."
"Was liegt euch denn so an mir?" fragte Tain unruhig. "Jeder ist ersetzbar."
"Niemand ist ersetzbar. Jeder hat seinen eigenen Wert."
"Technisch betrachtet ist jeder ersetzbar."
"Erstens wollen wir dich nicht ersetzen, und zweitens steht hier nicht das Technische im Vordergrund."
"Wenn ihr mich nicht in eurer Gewalt hättet, würde ich mit euch nichts mehr zu tun haben."
"Das kann ich dir nicht verdenken."
"Ich weiß also nicht, was das Ganze soll", begehrte Tain auf. "Wenn ihr mich hier weglaßt, habt ihr von mir rein gar nichts mehr."
"Das müssen wir hinnehmen."
"Aber dann war doch für euch alles umsonst."
"Wir haben unseren Auftrag erfüllt, so weit wie möglich in deinem Sinne zu handeln."
"Wenn ihr wirklich in meinem Sinne gehandelt hättet, dann hättet ihr nichts gegen meinen Willen getan."
"Was hättest du uns denn vorgeschlagen?"
"Mir in dieser Transporteinheit die Tabletten zu geben und mich anschließend einfach in Ruhe zu lassen."
"Dann wärst du nach ein paar Stunden tot gewesen."
"Das kannst du mir nicht erzählen", schüttelte Tain den Kopf. "Ich glaube dir kein Wort."
"Du mußt mir nicht glauben."
"Wann laßt ihr mich hier weg?"
"Wenn wir sicher sind, daß du überleben wirst."
"Es gibt keine Sicherheit, für niemanden", betonte Tain. "Irgendwann ist sowieso jeder an der Reihe."
Er zog den Rauch seiner Zigarette in sich hinein.
"Ihr genießt, daß ihr alles mit mir machen könnt, nicht wahr?" vermutete Tain und blies den Zigarettenrauch nach oben in die Luft. "Mein Anwalt hat schon gesagt, er kann mir nicht helfen, niemand hier kann mir helfen. Ihr seid Verbrecher, und ich bin euch ausgeliefert, dem ist weiter nichts hinzuzufügen."
Leen stand schweigend am Geländer.
"Auf was lauerst du?" fragte Tain. "Meinst du, ich mache mich selber kaputt? Rauchst du eigentlich nie?"
"Tain, hast du Angst vor dem Tod?"
"Das soll zynisch sein, oder was? Du hast gut reden ... du stehst schließlich auf der anderen Seite."
"Welche andere Seite?"
"Dir fehlt nichts, dir kann niemand etwas."
"Ich bin mit einem genetischen Defekt auf die Welt gekommen", erzählte Leen. "Ich muß Medikamente nehmen, und die bringen mich langsam um. Wahrscheinlich werde ich in den nächsten fünf Jahren sterben."
Tain hielt sich den Arm vors Gesicht und hustete. Leen ging zurück ins Haus.
"Meinst du, wir sollten ihm weniger Zigaretten geben?" fragte Rega, der am Fenster stand und Tain beobachtete.
"Laß' gut sein", winkte Leen ab. "Wir bevormunden ihn schon genug."
Etwa eine halbe Stunde später ging Sel Veey auf den Balkon und bat Tain, nach drinnen zu kommen. Tain folgte seiner auffordernden Handbewegung mit einem Seufzen.
"Du sollst dir in der Kälte nicht den Tod holen", erklärte Sel.
"Das wäre auch nicht das Verkehrteste", fand Tain.
"Willst du dir nicht helfen?" fragte Sel.
"Ich lohne mich nicht für euch", sagte Tain widerstrebend. "Ihr habt nichts von mir. Ich bin den Aufwand nicht wert, den ihr euch meinetwegen macht."
"Jeder ist für uns etwas wert."
"Und wenn ich vom Balkon springe? Dann ist alles, was ihr getan habt, umsonst."
"Willst du sterben?"
"Das ist hier nicht die Frage. Es geht darum, daß mein Leben innerhalb der Dauer eines Sprunges ausgelöscht werden kann. Und das rechnet sich doch nicht für euch."
"Das ist nicht unsere Art, zu rechnen. Wir versuchen, dich zu retten, und wenn wir es nicht schaffen, haben wir es doch wenigstens versucht."
"Wenn ich bloß wüßte, was euch an mir liegt ..."
"Ebenso viel wie an jedem anderen hier."
"Und um jeden macht ihr so einen Aufstand."
"Wenn es sein muß, sicher."
"Das ist aber doch ziemlich teuer, nicht?"
"Es ist uns nicht zu teuer."
"Uns?" fauchte Tain. "Sagst du 'uns'? Dich zumindest kann das doch hier alles nicht kümmern - als Automat, meine ich."
"Es kommt darauf an, wie ich programmiert bin."
- - -
Leen führte mit Staale ein Videotelefonat und erstattete Bericht:
"Wir haben eine künstliche Situation, weil Tain sich uns nicht entziehen kann. Wir können uns nicht wirklich mit ihm absprechen. Bisher hat er sich weder für das Leben noch dagegen entschieden."
"Also bleibt alles, wie es ist."
"Wir wissen nicht, ob Tain überlebt. Auch Rikka Vaillant weiß es nicht, und wenn sie es nicht weiß, weiß es wahrscheinlich niemand."
"Und wie steht es um dich selbst?" fragte Staale, der wußte, daß auf Leen ein früher Tod wartete.
"Vor allem denke ich an Lilly Giulini", erzählte Leen. "Sie ist mir vorausgegangen, und ich hoffe, sie wiederzusehen. In einem Traum hat sie zu mir gesagt, daß wir noch viel Zeit haben. Lilly hätte sich nicht an mich binden dürfen. Nur weil sie vor mir gehen mußte, ist sie dem Unheil entgangen."
"Welchem Unheil?"
"Ich bringe Trauer über jeden, der sich an mich bindet", meinte Leen. "Ich füge denjenigen Leid zu, die mir am nächsten stehen."
"Wie das denn?"
"Niemand kann sein Leben mit mir verbringen, denn ich gehe viel zu früh."
"Und deshalb darf niemand für dich etwas empfinden."
"Trauer bedeutet Beziehung. Es gibt keine Beziehung ohne Verlust. Wer niemals trauert, hat niemals geliebt. Wenn man jemanden liebt, wird man eines Tages trauern, das ist gewiß. Und das sollte nicht schon so bald sein."
"Wie war das damals mit Lilly Giulini?" erkundigte sich Staale.

"Lilly und ich sind uns zum ersten Mal in einer Steinwüste begegnet, der Geröllwüste beim trockengefallenen Flußtal von Timyran", erzählte Leen. "Wir haben uns im 'Departure' getroffen, einer verglasten Bahnhofsruine. Die Getränkekarte bestand aus einer Schiefertafel, und Lilly sah aus wie die Kreide dazu. Sie malte sich ihr Gesicht mit dünnen schwarzen Linien und rougte auch die Wangen, damit es menschenähnlicher wurde. Sie trug fast nur schulterfreie Decolletés und Reifröcke, ausschließlich in den Farben Zinnober, Schwarz und Tiefrot. Sie vertrug kein helles Licht und hatte deshalb meistens eine zinnoberrote Sonnenbrille auf. Sie wirkte zerbrechlich, aber daß sie einmal wirklich zerbrechen würde, hätte ich nicht geglaubt."
"Sie ist aber zerbrochen."
"Sie sagte zu mir, sie will vermeiden, daß andere auf sie hereinfallen und etwas in ihr sehen, das sie nicht ist. Ich meinte, ich sei überzeugt, daß sie all das sei, was ich erhoffe, und es käme auf ihr eigenes Vertrauen an. Sie nickte und gab mir seltsam glitzernde Steinchen, ähnlich wie Brillanten; ich sollte das nehmen, denn Tränen hatte sie nicht."
"Hat sie sich auf dich eingelassen?"
"Ich glaube, es ging vor allem darum, daß ich mich auf sie eingelassen habe."
"Habt ihr euch nur im 'Departure' gesehen?"
"Wir sind auch durch die Wüste gelaufen", erinnerte sich Leen. "Lilly ging mir voran auf einen hölzernen Steg. Ihr Rock schleifte über die Bretter. Der weiße Staub blieb an dem Stoff hängen. Wir befanden uns über einem Abgrund. Wir waren allein unter dem Himmel, in einem trüben, dunstigen Licht. Wir hingen aneinander mit verwischten Grenzen, ich wußte nicht mehr, was zu mir gehörte und was zu ihr. Es kam mir vor, als wenn wir zerfallen sollten und eins werden mit dem Staub unter uns."
"Wie lange kanntest du sie?"
"Kaum einen Sommer. Eines Morgens lehnte Lilly am Türpfosten im 'Departure' ... und lag auf einmal da und war noch weißer als sonst und ganz still. Wir konnten sie nicht mehr retten. Wir vermuten, sie hat sich an dem Pfosten gestoßen, und durch diese leichte Erschütterung geschah das, was ohnehin eines Tages geschehen wäre, hätte man das Risiko nicht doch rechtzeitig erkannt: eine Hirnblutung."
"Fühlst du dich schuldig?"
"Ich kann dieses Erlebnis nicht in solche Raster einordnen. Ich kann es überhaupt nicht verarbeiten. Ich hoffe nur, daß es nach dem Tod noch ein Leben gibt und daß ich es mit Lilly teilen kann: Eine Ewigkeit, die uns gehört und in der wir uns gehören."
- - -
"Sel, merkst du dir eigentlich alles, was du siehst und was man zu dir sagt?" wollte Tain wissen. "Ich meine, wie eine Kamera? So mit Datenträgern, die sich auch die anderen ansehen können?"
Sel nickte.
"Das heißt, Leen kann alles von dir herunterladen und weiß genau ...", überlegte Tain. "Und was ist, wenn du ihm nicht alles erzählen willst? Kannst du das dann auch für dich behalten?"
"Das könnte ich zwar, aber das ist nicht Sinn der Sache."
"Kannst du dich schämen? Kannst du dir wünschen, etwas geheimzuhalten?"
"Ich bin kein lebendes Wesen, Tain."
"Das heißt, du hast auch keinerlei Sehnsüchte, keinerlei Bedürfnisse ..."
"So ist es."
"Und wenn man dir keinen Strom gibt? Wenn du ausgehst? Ich meine, wenn du einfach abgeschaltet werden sollst?"
"Dann werde ich abgeschaltet."
"Also, du hängst gar nicht an irgendwas? Du wünschst dir gar nicht, etwas zu erleben und noch einmal und noch einmal zu erleben?"
"So ist es."
"Und du hast niemals Angst, etwas zu verlieren. Du hast niemals Angst, dich selber zu verlieren."
"Nein."
"Du weißt gar nicht, was Angst ist."
"Nein, das weiß ich nicht", bestätigte Sel. "Kannst du es mir denn erklären?"
Tain schaute um sich. Sein Zimmer in dem Institut in SalaRien war geräumig und kaum eingerichtet. Es wirkte ruhig, wie eingegossen in Nebel, der jeden Laut schluckt und den Blick verhüllt. Man konnte diesem lichten, weiten Raum nicht ansehen, welche Bedrohung darin wartete.
"Ich kann mich nicht erinnern, jemals Angst gehabt zu haben", sagte Tain nachdenklich. "Ich empfinde nur Haß auf die Leute, die mich hier Tag für Tag angreifen. Dich kann ich nicht hassen, es wäre nicht logisch. Du bist nur ein seelenloser Roboter. Du als Maschine gehörst dir nicht selbst, du hast kein Ich zu verteidigen, und du hast auch kein Ich zu befriedigen. Insofern greifst also nicht du mich an, sondern es sind die Leute, die dir Befehle geben. Und nur gegen die richtet sich der Haß ..."
"Und wenn diese Leute jetzt alle weggehen würden und sich nie mehr um dich kümmern würden?"
"Was würde dann geschehen, Sel? Das möchte ich wissen. Hat Leen es dir gesagt?"
"Ich weiß bescheid", nickte Sel.
"Hat er dir gesagt, du sollst schweigen?" fragte Tain und wußte nicht, was ihn außer Atem gebracht hatte. "Würdest du mir auch etwas sagen, wenn er es dir verboten hätte? Kannst du lügen?"
"Leen verbietet mir nichts."
"Was hat er gesagt ..."
"Er wird dem Schicksal dankbar sein, wenn es dich verschont."
"Und was soll das heißen?"
"Daß wir dir vielleicht noch helfen können."
"Und vielleicht auch nicht."
"Und vielleicht auch nicht."
Tain suchte etwas, woran er sich festhalten konnte, ohne daß Sel auffiel, daß er sich festhalten wollte. Er griff schließlich nach der Fensterbank und blickte angestrengt nach draußen.
"Setz' dich lieber hin", riet Sel.
"Du redest so besorgt", fand Tain. "Bist du denn wirklich besorgt um mich? Ich meine, empfindest du ... ach, die Frage erübrigt sich; du kannst doch gar nichts empfinden."
"Ich habe ein Programm, das mit Gefühlen vergleichbar ist. Dieses Programm übersetzt mir, was jemand empfindet. Und ich antworte darauf mit einem bestimmten Muster."
"Wessen Muster?"
"Das Muster meiner Schöpfer."
"Wer sind die?"
"Darauf gebe ich keinen Zugriff."
"Kann Leen eigentlich jederzeit auf dich Zugriff nehmen?"
"Nur von einem Rechner aus."
"Wenn er also jetzt gerade an so einem Rechner sitzt - oder einen in der Hand hat -, weiß er, was du zu mir sagst und was ich zu dir sage? Und was du siehst?"
"Das ist richtig."
"Und kann er dir auch jetzt, in diesem Augenblick, Befehle geben, was du sagen sollst oder was du tun sollst?"
"Er muß es nicht, aber er kann es."
"Und gibt er dir jetzt gerade Befehle?"
"Darauf gebe ich keinen Zugriff."
"Ich weiß also nie, wen ich vor mir habe, dich oder ..."
"In gewisser Weise hast du nie mich vor dir, weil es mich als Ego gar nicht gibt, sondern nur als Programm."
"Mußt du nie lachen?"
"Tain, du hast eine Maschine vor dir; was erwartest du?"
"Du hast keine Schwächen, dich rührt nichts, du bist unangreifbar."
"Das stimmt, das ist auch so gedacht. Ich bin unendlich belastbar, weil mich nichts belastet. Man kann mir jede Aufgabe zuteilen, die ein lebendes Wesen emotional überfordern würde. Dafür bin ich da. Ich bin ein Gegenstand und bleibe darauf beschränkt. Ich lebe nicht und kann den Reichtum des Lebens nie erfahren."
"Manchmal denke ich, ich will auch nur eine Maschine sein."
"Kannst du dir vorstellen, wie das ist, keinen eigenen Willen zu haben?"
"Keinen eigenen Willen?"
"Nur Lebewesen haben einen eigenen Willen."
"Das heißt, nur weil ich einen eigenen Willen habe, kann ich angegriffen werden ... und hasse ... und muß diese Leere empfinden ..."
"Das ist der Preis, Tain."
"Sonst würde mich das gar nicht berühren, was ihr mit mir macht ... es wäre mir alles egal."
"So ist es."
"Das heißt, dir ist das auch vollkommen egal, wenn Leen dich fernsteuert und benutzt ... und dir seinen Willen aufnötigt ..."
"Ich bin dazu da, eben dazu", erklärte Sel. "Maschinen entstehen nicht von selbst, sie werden immer zu einem bestimmten Zweck hergestellt. Sonst würde es sie gar nicht geben; weshalb auch?"
"Das heißt, wenn ich nichts empfinden würde, wenn mich nichts belasten würde, wenn ich mich nie angegriffen fühlen würde ... dann hätte ich auch keinen eigenen Willen."
"Richtig."
"Das heißt, wenn man einen eigenen Willen hat, bezahlt man dafür mit Verletzbarkeit."
"Immer."
"Und daß man verletzbar ist, ist ein Zeichen dafür, daß man einen eigenen Willen hat."
"Das stimmt."
"Also macht Willensstärke angreifbar", überlegte Tain, "und wenn jemand besonders willensstark ist, kann er auch besonders leicht verletzt werden."
"Ja."
"Ist Leen eigentlich auch verletzbar?"
"Ja, sicher."
"Und er ist auch schon mal verletzt worden?"
"Das bleibt nicht aus."
"Und was macht er, wenn er Angst hat, daß ihn jemand verletzt?"
"Er versucht, die Angst zu überwinden."
"Und wie macht er das?"
"Wenn er etwas Bestimmtes will, setzt er es durch, gegen die Angst."
"Und gibt es nichts, das er nicht schafft?"
"Es gibt immer etwas, das man nicht schafft."
"Kann ich ihn auch verletzen?"
"Sicher."
"Wenn ich ihn hasse?"
"Nicht durch Haß, Tain. Durch etwas anderes."
"Wodurch? Sag' es mir."
"Eigentlich weißt du es längst."
"Ich weiß gar nichts."
"Du weißt, was er erreichen will."
"Leen beabsichtigt, meinen Willen zu brechen."
Sel schüttelte den Kopf.
"Doch", war Tain überzeugt. "Er möchte, daß ich alles hinnehme, daß er immer die Macht über mich hat. Er braucht mich, damit er Macht ausüben kann."
Sel schwieg.
"Nun sag', ist es so?" forschte Tain.
"Du bist dir schon so sicher", meinte Sel, "da mag man gar nichts erwidern."
"Und ich will doch etwas hören."
"Was willst du denn hören?"
Tain überlegte, was er erwidern konnte, und schaute auf die Uhr an der Wand.
Leen kam herein und setzte sich in einen Sessel.
"Was habt ihr vor?" erkundigte sich Sel.
"Das eilt nicht", meinte Leen. "Heute kommt es nicht so auf die Zeit an."
Tain ging im Zimmer herum. Niemand sprach, niemand regte sich, nur die Uhr lief weiter. Der Nebel riß auf, und ein perlmuttfarbenes Licht wagte sich durch die Fensterscheiben.
Inir Bendthaus betrat den Raum, in einer graugrünen Kittelschürze. Sie hatte ihr volles blaues Haar auf dem Kopf zusammengeringelt und mit schimmernden Haarperlen verziert, die die Form kleiner Seesterne hatten. Inirs Augen waren mit feinen blauen Linien ummalt.
"Sie ist ein Kunstwerk", beschrieb Sel. "Nur eben nicht im Sinne eines Androiden; sie ist ihr eigenes Geschöpf."
Inir stellte ihren Kaffeebecher auf ein Sims.
"Wie sieht es denn aus?" fragte sie. "Wollt ihr mitkommen?"
"Tain, willst du mit Inir schon vorgehen?" fragte Leen. "Dann kann ich hier noch etwas besprechen."
"Wie findest du das eigentlich?" wandte Tain sich an Inir. "Leen ist es egal, um was ich andere gebeten habe und um was nicht. Er entscheidet, was ich zu wollen habe und was mit mir gemacht wird."
"Warum tut er das denn?" fragte Inir.
"Er behauptet, daß ich in Gefahr bin, wenn er nicht alles mit mir machen kann, was ihm einfällt."
"Bist du denn in Gefahr?"
"Man kann nie sagen, man ist nicht in Gefahr; jeder ist auf irgendeine Art in Gefahr, und wenn man jemandem nur lange genug einredet, er ist in Gefahr, dann glaubt er es am Ende auch. Ich glaube es aber nicht - nicht mehr."
"Du glaubst, Leen sagt dir nicht die Wahrheit."
"Ich glaube das einfach nicht, daß ich ..."
"Tain, doch, du hättest tot sein können."
"Ich kann mir das nicht vorstellen."
"Und wir hätten um dich getrauert."
"Um mich kann man gar nicht trauern", erwiderte Tain aufgebracht. "Ich habe mich nie an jemanden gebunden, also kann ich auch niemandem etwas bedeuten."
Leen winkte Sel zu sich und gab ihm Zeichen. Tain verschränkte die Arme, um das Zittern zu verbergen, das ihn anfiel.
"Ich weiß gar nicht, was ihr hier wollt", sagte Tain und hob die Schultern.
Leen stand auf.
"Sel und ich gehen jetzt weg", erklärte er, zu Tain gewandt. "Inir bleibt hier, und wir warten, bis du mit ihr nach nebenan kommst."
Tain nahm seine Zigaretten mit auf den Balkon. Inir trank Kaffee. Wenn ihr Becher leer war, schenkte Casyle ihr nach. Casyle blieb auch da, als Inir an Tains Laptop spielte. Tain hatte ihr einige Spiele geliehen, und am Vortag hatte er neue Spiele geschickt bekommen, die Inir noch nicht kannte.
"Es ist heute besonders kalt", sagte Casyle schließlich. "Das gefällt mir nicht, daß Tain immer so lange draußen ist."
Inir öffnete die Balkontür und winkte zu Tain hinüber. Er blickte sie nicht an. Sie ging zu ihm und bat:
"Komm' 'rein, das ist nicht gut bei der Kälte."
Er antwortete nicht. Inir zog ein blaues Telefon hervor, das einem bemalten Stück Holz ähnelte, und tippte darauf. Kurze Zeit später kam Sel heraus.
"Kommst du mit?" fragte er.
Tain rührte sich nicht.
"Wirf' die Zigarette weg, du verbrennst dich", riet Inir.
"Ist das Treibholz?" fragte Tain mit einem Blick auf ihr Telefon.
"Es ist leicht wie Treibholz", nickte sie, "als hätte ich es am Strand gefunden."
"Frierst du nicht?" erkundigte sich Sel.
Tain schüttelte den Kopf.
"Komm' mit nach drinnen", forderte Sel ihn auf. "Es ist dann einfacher."
"Erst laßt ihr mich hier in Ruhe, und auf einmal ..."
"Wir haben darauf gewartet, daß du dich von Inir nach nebenan bringen läßt."
"Es ist unverantwortlich", meinte Tain. "Inir hätte mich niemals zurückhalten können, wenn ich über das Geländer gestiegen wäre. Sie hätte mitansehen müssen, wie ich zu Tode gefallen wäre."
"Wenn du sterben willst, können wir das letzten Endes nicht verhindern."
"Was ist das nur für ein Unsinn ... habt ihr denn gar nichts Besseres zu tun?"
"Im Augenblick geht es um dich und sonst um nichts."
Tain fiel auf, daß man Sels Atem in der Kälte nicht sah - eben weil er nicht atmete.
"Tain, denkst du, es ist besser für dich, wenn wir die Balkontür abschließen?" fragte Sel.
"Kann ich dann im Zimmer rauchen?"
"Nein."
"Dann laßt sie offen, und ich bleibe hier draußen."
Tain trat seine Zigarette auf dem Balkonboden aus. Er stellte fest, daß die Zigarettenschachtel leer war.
"Hol' mir doch mal Zigaretten", wies er Inir an.
Alles schwieg, auch Casyle, die durch die Balkontür schaute.
"Was ist jetzt?" fragte Tain ungehalten.
Als weiterhin nichts geschah, lief Tain an Casyle vorbei zu seinem Schrank und wollte eine neue Schachtel hervorsuchen. Unterdessen waren Sel und Inir ihm ins Zimmer gefolgt, und Sel schloß die Balkontür ab.
"Das war nicht ausgemacht", beschwerte sich Tain. "Ich will jetzt rauchen."
"Inir, sagst du Rega und Léry bescheid?" bat Sel. "Sie sind eins höher."
Inir tippte auf ihr blaues Stück "Treibholz".
Tain ließ seinen Blick wandern und untersuchte jede Einzelheit im Zimmer auf die Eignung zu irgendeiner Art der Flucht. Er sah das Bett vor sich stehen und fühlte das drängende Bedürfnis, sich auszuruhen. Ihm war, als wenn sein inneres Gerüst in sich zusammenfallen wollte und ihn nicht mehr trug.
Sel hatte ihm unversehens den Mantel von den Schultern gezogen.
"Ich habe einen Moment nicht aufgepaßt", sagte Tain wie entschuldigend, "aber ich sage dir, du faßt mich nicht an."
"Willst du dich auf das Bett legen?" fragte Sel.
Statt zu antworten, nahm Tain das Laptop vom Tisch und setzte sich in einen Sessel. Er wollte mit dem Spiel fortfahren, das Inir begonnen hatte. Kurz darauf sah er das Laptop in den Händen von Rega.
"Was willst du mit dem?" fragte Tain wütend. "Gib' das wieder."
"Es ist dir eben fast aus der Hand gefallen", erklärte Rega.
"Das ist nur, weil ich nicht genug schlafe", meinte Tain. "Und ich sage euch, Leen kommt nicht mehr in dieses Zimmer."
"Er ist doch hier."
"Er hat hier nichts zu suchen. Nichts."
"Er ist hier, aber du mußt mit ihm nicht sprechen."
"Das würde ich eh nicht. Ihr schickt ihn weg, sofort. Und macht das Licht aus. Wie kommt ihr überhaupt darauf, das Licht anzumachen ..."
"Kannst du aufstehen?" fragte Inir. "Schaffst du das?"
"Ihr sollt das Licht ausmachen, sofort."
"Es geht darum, daß du von dir aus mitkommen kannst", erklärte Leen. "Es geht darum, daß das nicht gegen deinen Willen ist."
"Ihr macht das Licht aus", forderte Tain. "Und ihr faßt mich nicht an, das habe ich gesagt, ihr faßt mich nicht an."
"Leen, das gefällt mir nicht", sagte Inir. "Tain gefällt mir nicht."
"Meinst du, er schafft es nicht?"
Inir schüttelte den Kopf.
Tain fühlte Abscheu gegen seinen Körper, der ihn im Stich ließ im Kampf um seinen eigenen Willen. Er wollte sich verlassen und vernichten. Ihn hielt nichts an dem, was er war.
- - -
Rega saß am Kaffeetisch mit einem zweifelnden, nachdenklichen Blick.
"Es war sonst leichter", meinte er. "Vielleicht sollten wir ihm nicht so viel Zeit lassen."
"Meine Hoffnung ist, daß Tain sich für das Leben entscheidet", sagte Leen. "Bisher hat er sich für nichts entschieden."
"Kannst du es akzeptieren, wenn er sich für den Tod entscheidet?"
"Wenn Tain sterben will, wird er sterben", war Leen sicher. "Damit muß ich zurechtkommen."
"Aber was macht das mit dir?" fragte Rega. "Und was macht das aus dir? Als Befehlsempfänger von Staale?"
"Wenn es nur ein Befehl wäre und ich das hier nicht mittragen könnte, hätte ich diese Aufgabe nicht so umsetzen können. Mir geht es tatsächlich darum, daß Tain sich dem Leben zuwendet. Es ist mir ein Anliegen, das auch mit meinem eigenen Tod zu tun hat."
"Was macht Staale eigentlich mit Leuten, die sich nicht an seine Befehle halten?"
"Er versucht, sie zu überzeugen."
"Und wenn das nicht geht?"
"Es gibt nicht in jedem Fall einfache Lösungen", meinte Leen. "Man muß Kompromisse finden, wenn man sich nicht gegenseitig demontieren will."
"Inir, du sagst gar nichts", wandte sich Rega an die Kollegin. "Wie hättest du dich an Leens Stelle verhalten?"
"Vielleicht wäre ich vorsichtiger gewesen", vermutete sie. "Ich hätte die Balkontür wahrscheinlich von Anfang an abgeschlossen. Und ich hätte heute nicht so lange darauf gewartet, daß Tain von selbst mit mir kommt. Leen soll mehr erreichen, als Tain nur vor dem Tode zu bewahren. Deshalb ist er hier, und ich könnte ihm das nicht abnehmen. Es geht um den Lebenswillen von Tain, und das kann man nicht zwischen Tür und Angel abhandeln. Leen entlastet mich, und er entlastet auch mein Gewissen."
Durch die Fenster floß kaltes graurotes Dämmerlicht. Die Jalousien waren noch nicht heruntergelassen worden. Die Deckenstrahler spiegelten sich als silberweiße Punkte in den großen Glasscheiben.
Inir hatte ein netzartiges Gewand über ihr Kleid gezogen und trug Muschelketten um den Hals. Ihre Ohrringe waren holzgeschnitzte Seepferdchen.
"Das Wasser überflutet den Sand, ein Ozean von Tränen", sagte sie. "Die Augen öffnen sich in ein helles Nichts. Einmal aufgestoßen, kann die Tür nicht mehr geschlossen werden. Das Wasser bricht ein, um fortzuspülen und zu ertränken."
"Wie kommst du auf solche Verse?" wollte Rega wissen.
"Ich war auch mal zwischen Leben und Tod", erzählte Inir, "zwischen dem Meer und dem Ufer."
"Wie kam das?"
"Es war wie im Märchen. Ich hatte keine Stimme mehr, und eigentlich hätte ich ersticken müssen, als ich das Meer für immer verlassen wollte. Ich saß auf einer Betontreppe am Strand. Léry gab mir ein Kästchen, in dem war nichts als Sand und Salzwasser, aber das hat mir die Freiheit gebracht - und meine Stimme gerettet. Unsere Hochzeit haben wir darum mit Salzwasser begossen."
- - -
In der Nacht wollte Tain auf den Balkon hinausgehen, aber die Tür ließ sich noch immer nicht öffnen.
Am Hang gegenüber blinkten die Lichter von Birkwald, ein helles Straßennetz. Der Himmel glich einer rauchblauen Waschküche. Eine Lüftungsklappe über der Balkontür stand offen. Draußen schien es wesentlich kälter zu sein als am vergangenen Nachmittag.
Tain wußte, daß die Rauchmelder anschlagen würden, wenn er im Zimmer oder im Bad rauchte. Und den Kameras im Flur wollte er um diese Uhrzeit nicht begegnen. Er glaubte nicht daran, es bis zu einer der Ausgangstüren schaffen zu können, ohne daß ihn jemand abfing.

Tain suchte im Dunkeln nach seinem Telefon und nahm schließlich das leichte, kleine Stück "Treibholz", das Inir ihm hingelegt hatte. Man konnte es durch diagonales Ziehen vergrößern, wobei sich auch das wie aufgemalt wirkende Display vergrößerte. Tain wählte Leens Nummer.
"Ja?" meldete sich Leen.
"Machst du den Balkon auf?" verlangte Tain. "Ich will auf den Balkon gehen und rauchen."
"Morgen geht das wieder."
"Morgen, sagst du?" fragte Tain in einem harschen Tonfall. "Ich glaube, mir ist alles egal. Mir kommt es auf nichts mehr an. Du kannst einen Raucher nicht auf 'morgen' vertrösten."
"Hast du noch Nikotinkaugummis?"
"Was?" rief Tain. "Bleib' mir da bloß weg mit. Fang' mir da bloß nie wieder mit an. Also - entweder geht der Balkon sofort auf ... oder ich zerlege hier die Einrichtung."
"Du darfst die Einrichtung zerlegen."
"Das stört niemanden, oder was?"
"Du darfst es jedenfalls."
"Was ist denn von mir noch übrig, wenn ich mir alles vorschreiben lasse?" fragte Tain und brachte kaum die Worte hervor. "Was hat das für einen Sinn, wenn ihr mich ebenso in eine Laufpuppe verwandelt, wie Sel Veey eine ist?"
"Einer der Hochleistungsrechner hier im Institut wurde mit Lanwer verschaltet", berichtete Leen. "Staale bittet dich, daß du schon mit ihm arbeitest - mit Lanwer arbeitest -, damit es nicht so viel Ausfall gibt."
"Und was hast du dazu gesagt?"
"Daß ich dich frage, ob du willst, denn du mußt es nicht tun."
"Wann soll das sein?"
"Wenn es Tag wird, kannst du an den Rechner. Staale richtet sich nach den Tag- und Nachtzeiten in Stellwerk, damit hier nicht der Rhythmus durcheinandergerät."
In dem Raum, wo sich der Rechner befand, hingen dünne Tafeln an den Wänden, Monitore, wie Tain sie aus seinem Arbeitsbereich in Stellwerk und aus der Transporteinheit kannte. Staale hielt sich nicht mit Fragen auf, sondern begann sofort ein Gespräch über sachliche Details. Tain hätte gern mehr über L /. 7 gehört, merkte jedoch, daß sich während seiner Zeit in SalaRien vieles angestaut hatte, was nur er selbst bearbeiten konnte. Staale wollte dies nun möglichst rasch aufholen.
Tain kam nicht dazu, auf die Uhr zu schauen. Staale sagte schließlich durch den Lautsprecher:
"Für heute genügt es. Ich blende einen Bildschirmschoner ein."
Es erschienen schemenhafte weiße Vögel, die auf Tain zuflatterten. Inir räumte das Kaffeegeschirr weg. Sie hatte Bänder aus graugrüner Seide in ihr Haar geflochten, und um ihre Taille lag ein Gürtel aus graugrünen Seidensträngen, die an Seetang erinnerten.
Tain fühlte sich etwas matt und wollte sich in seinem Zimmer ausruhen.
"Sie ist zu", entfuhr es ihm, als er die Klinke herunterdrückte.
Er suchte nach jemandem, der ihm öffnen konnte. Sie hatten alles geordnet wie einen Fangkäfig; hinter ihm raschelte eine Flügeltür ins Schloß, und vor ihm teilte sich eine andere, als wollte sie ihn mit einladender Gebärde leiten.
Der Weg war Tain vertraut und wirkte doch fremd, denn er ging ihn zum ersten Mal selbst.
Hinter einer stählernen Schiebetür lag das Zimmer mit den Milchglasfenstern, das Tain wohl kannte, das ihm jedoch seltsam groß vorkam. Es gab überall Tische, an den Wänden und in der Mitte. Einen Stuhl gab es nicht.
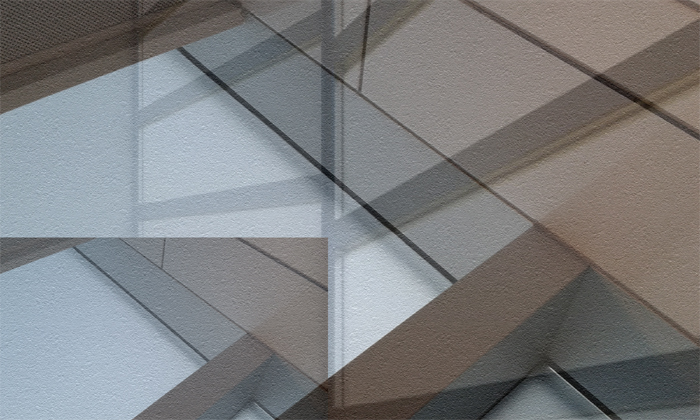
Leen kam herein und holte verschiedene Sachen aus einer Schublade.
"Tain, das hier hat dich bisher vor dem Tode bewahrt", sagte er. "Willst du es dir ansehen?"
"Deshalb bin ich nicht hier. Ihr habt mein Zimmer abgeschlossen."
Leen gab Tain den Schlüssel.
"Kommst du wieder, wenn du es aufgeschlossen hast?" fragte er. "Dann kannst du mir den Schlüssel auch gleich wiedergeben."
Tain sagte nichts und rührte sich nicht.
"Das muß nicht gleich sein", setzte Leen hinzu. "Das kann auch sein, wenn wir hier fertig sind."
Leen trug ein graues Kunststoffhemd, in dem Tain ihn schon öfter gesehen hatte. Tain fühlte sich auf unbestimmte Art an einen Schlachthof erinnert, er wußte aber nicht, wie er darauf kam. Vielleicht lag es an den Kacheln; in Schlachthöfen waren die Wände auch oft gekachelt.
Tain entdeckte Ziffern, die an die Wand gemalt schienen. Die rechte Ziffer änderte sich. Tain sah die Zeit dahingehen, ein Zerfallen ohne Halt, ein Abgrund ohne Ende.
Leen ging in den angrenzenden Raum. Tain überlegte, was er tun konnte. Ihm standen mehr Fluchtwege offen als sonst. Sel hatte ihm das Gebäude gezeigt, und Tain wußte, wo man hinauskam. Er versuchte, sich vorzustellen, was mit ihm geschehen konnte, wenn er tatsächlich ging.
"Leen?" fragte Tain vorsichtig.
"Was gibt es?"
"Was passiert, wenn ich gehe?"
"Was sollte passieren?" fragte Leen und kam ein Stück näher.
"Ich meine, was passiert mit mir?"
"Das kann ich nicht sicher voraussagen."
"Glaubst du, ich sterbe dann?"
"Das ist wahrscheinlich."
"Aber ich fühle den Tod gar nicht. Woher soll ich wissen, daß da wirklich diese Gefahr ist?"
"Die Ergebnisse zeige ich dir gerne."
"Das ist doch sowieso alles gelogen."
Sel Veey kam herein und wirkte sehr geschäftig. Tain mußte daran denken, daß der Android immer wach war, immer aufmerksam - sofern er genügend Strom zur Verfügung hatte.
"Sel, daß du das hier einfach alles so mitmachst", wunderte sich Tain, "dafür muß man schon eine Maschine sein - oder ein Sklave. Was wäre eigentlich, wenn man dir befehlen würde, einen Mord zu begehen?"
"Wenn man meine Programmierung entsprechend ändert, wäre ich dazu in der Lage."
"Und wenn man dich dazu verwenden würde, perverse Spielchen mitzumachen? Oder dir befehlen würde, dich selbst auseinanderzubauen, so daß man dich nicht mehr zusammenbauen kann?"
"Sicher, auch das wäre möglich", erklärte Sel. "Ich gehorche den Gesetzen der Physik, nicht denen der Seele. Eine Gummipuppe hat auch keine Seele, mit der kann man auch alles machen."
"Ekelst du dich niemals?"
"Das ist ein menschliches Gefühl, das ist mir fremd."
"Dann hast du doch gar keine Moral, keine ... Würde."
"Ich habe nur so viel Gewissen wie meine Programmierer."
"Dann kann man aber doch gar nicht ausgelieferter und abhängiger sein als du."
"Richtig."
"Und das berührt dich nicht."
"Richtig."
"Ein Leben ohne Gefühle ist ein Leben ohne Würde."
"Richtig."
"Nur wer etwas zu verteidigen hat, kann in seiner Würde verletzt werden."
"Richtig."
"Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal 'raus und rauche eine", seufzte Tain. "Mir wird das hier gerade alles zuviel."
"Tain, kommst du mit?" fragte Leen.
Tain vermochte nicht zu antworten. Er sah zwei Leute hereinkommen: Léry und Seera. Von Seera wußte Tain, daß er stumm war. Von ihm selbst jedoch wurde erwartet, daß er sich äußerte. Wenigstens "Nein" sollte er sagen oder sich in irgendeiner Weise erklären. Doch die Zeit verrann, und Tain schwieg. Er sah seine Existenz in Trümmern, weil er sicher war, versagt zu haben und auch in Zukunft zu versagen.
"Du hast so viel getan, du mußt nichts mehr tun", sagte Leen. "Du bist uns nichts schuldig."
"Und wovon soll ich leben?"
"Du wirst nicht untergehen."
"Darum geht es nicht", erklärte Tain. "Wer versagt, ist selber schuld."
"Warum?"
"Das ist eben so."
"Ist Sel auch selber schuld, wenn man ihn in Einzelteile zerlegt?"
"Er ist eine Maschine, der kann an nichts schuld sein."
"Und du?"
"Es darf nicht sein, daß andere mich beherrschen."
"Wer soll dich beherrschen, wir oder der Tod?"
"Ich kann mich doch gar nicht wirklich entscheiden. Wenn ich sage, ich will sterben, läßt du mich doch nicht."
"Ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck, daß du sterben willst", meinte Leen. "Was ich wissen möchte, ist, auf welche Art du am Leben bleiben willst."
"Das nimmst du mir auch ab."
"Hast du einen anderen Vorschlag?"
"Wenn ich eine allumfassende Macht über mein Schicksal hätte, könnte mich niemand und nichts angreifen."
"Du hast diese Macht nicht", sagte Leen bestimmt. "Der Tod ist in dir, er zehrt an dir."
"Das ist nicht wahr."
"Willst du wissen, was wir machen und warum?"
"Bloß nicht. Ihr lügt sowieso."
Wie gebannt blieb Tain stehen und betrachtete Léry und Seera, die sich langsam näherten.
"Tain, du kannst nach draußen gehen, wenn du willst", sagte Leen.
Tain rührte sich noch immer nicht, als das Licht hochgedreht wurde.
- - -
"Eigentlich ist es doch Alltag", sagte Léry am Küchentisch. "Das ist nichts, was ungewöhnlich wäre, und doch ist etwas anders, ganz anders ..."
Über die graue Rückwand rieselte weißes Licht aus einer dünnen Leuchtschiene. In Seeras Augen stand Fassungslosigkeit. Er betrachtete seine Hände, als würden sie nicht zu ihm gehören. Auf den Monitor in der Tischplatte schrieb er:
"Wer ist woran schuld?"
"Es gibt nichts, was so sehr verunsichert wie Konflikte", meinte Leen. "Wenn es kein einfaches 'Richtig' oder 'Falsch' gibt, führen die Leute Krieg gegeneinander oder mit sich selbst - es sei denn, sie nehmen den unauflösbaren Konflikt an als Teil der Wirklichkeit."
"Und was ist mit der Schuld?" schrieb Seera.
"Schuldfragen führen häufig in die Irre", sagte Leen dazu, "vor allem, wenn 'Richtig' oder 'Falsch' nicht klar zu unterscheiden sind."
- - -
Leen erstattete Bericht an Staale.
"Du siehst schlecht aus", meinte Staale, "oder liegt es nur an der Verbindung?"
"Ich beginne schon, an mir selber zu zweifeln."
"Selbstzweifel sind ein gefährlicher Sog", warnte Staale, "und sie lassen dich spüren, wie gefährlich Tains eigene Selbstzweifel sind. An deiner Stelle hätte ich Tain gar nicht erst auf den Balkon hinausgehen lassen, auch nicht in Begleitung."
"In Tain lebt ein ungebändigter Haß, sein Selbsthaß."
"Es gibt noch die andere Seite, die so leicht übersehen wird."
"Das ist es, wonach ich suche, dieses Stück Bescheidenheit, das Hinwendung zu den Menschen bedeutet."
"Vielleicht gelingt es dir, einem Menschen die Tür zu öffnen, der immer gefangen war."
"Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der das schaffen kann."
"Willst du diesen Auftrag abgeben?"
"Wenn ich ihn abgebe, wer soll es dann an meiner Stelle machen?"
- - -
"Tain fühlt sich von dir verraten", sagte Inir in der Küche zu Leen, "weil ihr vorher schon miteinander bekannt wart. Du lenkst also noch weit mehr Haß auf dich, als ich es könnte. Und du erregst Tains Neid. Tain merkt, daß er etwas nicht kann, was für dich ein Leichtes ist. Du kannst abgeben, du kannst abwarten, du kannst im Hintergrund bleiben. Tain will alles für sich, hat keine Geduld und muß sich in den Vordergrund stellen."
"Mit Haß kann ich schlecht umgehen, selbst wenn er nicht gegen mich gerichtet ist", erzählte Leen. "Haß ist für mich eine Grundstimmung, eine Atmosphäre, der ich mich nicht entziehen kann."
"Was willst du dagegen tun?"
"Ich versuche, die Botschaft hinter dem Haß zu verstehen - und auf sie zu antworten. Nicht jeder, der haßt, ist von Grund auf zerstörerisch. Haß kann auch ein Mittel zum Zweck sein. Hinter dem Haß kann man etwas verstecken."
"Das klingt nach lauter Rätseln."
"Wenn Tain sich mit mir auseinandersetzt, setzt er sich in Wahrheit mit sich selbst auseinander."
"Was soll das denn bringen?"
"Ein Krieg im Inneren ist schlechter auszuhalten als ein Krieg auf der Bühne."
"Und wenn Tain mit dir Krieg führt, was soll dabei herauskommen?"
"Meine Hoffnung ist, daß Tain sich nicht umbringt."
"Soll er dich stattdessen umbringen?"
"Das halte ich nicht für wahrscheinlich."
"Warum nicht?" fragte Inir. "Du bist doch sein ärgster Feind."
"Tains ärgster Feind ist der Tod", erwiderte Leen, "und ich glaube, ihm wird das allmählich bewußt."
- - -
Tain baute die Verbindung zu Lanwer auf. Wieder ließ Staale ihm keine Zeit zum Nachdenken; er erkundigte sich nicht einmal danach, wie es ihm hier in SalaRien erging. Schließlich verabschiedete er sich von Tain mit den Worten:
"Bis morgen, um dieselbe Zeit."
Dieses Mal gab es einen anderen Bildschirmschoner. Reetgräser bewegten sich im Wind, und ihre blauroten Spitzen bildeten immer neue fraktale Wellenmuster.
"Hast du die Vorhänge schon gesehen, die ich aufgehängt habe?" fragte Inir, als sie hereinkam.
Es waren Bahnen aus durchsichtigem Batist, auf den in gleichmäßigen Abständen echte Muscheln genäht waren, so vielfältig, wie sie am Strand gefunden werden.
"Du verzierst nicht nur dich, sondern auch das Haus", bemerkte Tain.
"Die neuen Sitzpolster in der Kaffeeküche sind gemustert mit Meerestieren in Lichtblau", erzählte Inir, "den Stoff habe ich kürzlich im Katalog gefunden. Und die Scheibengardinen sind aus Filetgarn gehäkelt mit denselben Motiven. Diese Handarbeit ist für mich wie ... Meditation."
"Warum lebst du eigentlich hier und nicht im Meer?"
"Ich will lieber Beine haben als einen Fischschwanz."
"Kannst du unter Wasser atmen?"
"Nein, dafür kann ich es hier."
Tain machte sich auf dem Weg zu seinem Zimmer. Wie am Vortag fand er es verschlossen. Langsam stieg er die Treppe hinunter, an einer hohen Wand aus Glasbausteinen entlang, in der sich das Dämmerlicht brach. Vor der Außentür schlug ihm ein frostiger Wind entgegen.
"Es gibt eine Bahnbrücke in der Nähe", fiel ihm ein. "Die Züge fahren dort sehr schnell, und wenn ich ..."
"Wo willst du hin?" fragte Sel und stellte sich neben ihn.
Tain antwortete nicht.
"Wenn du wegläufst, hast du doch ein Ziel", meinte Sel. "Dann willst du doch irgendwo hin."
"Ich weiß nicht, wo ich hinwill, aber hier bleibe ich nicht."
"Willst du denn hier stehenbleiben?"
"Jedenfalls läßt du mich jetzt endlich in Ruhe."
Sel reichte Tain dessen Mantel. Tain zog ihn über und ging Schritt für Schritt auf die nahegelegene Bahnstation zu, ohne sich umzudrehen. Er rechnete stets damit, daß er am Weitergehen gehindert wurde. Dies geschah jedoch nicht.
Tain nahm den Zug nach Birkwald. Er konnte seine Wohnung noch öffnen; der Code war nicht geändert worden. Alles war aufgeräumt, die Zimmer waren gelüftet, das Bett frisch bezogen. Jemand hatte hier regelmäßig für Ordnung gesorgt.
Tain ging nachts aus und traf einige Bekannte, die nicht wußten, was ihm in SalaRien widerfuhr. Unter ihnen war auch Berenice. Sie trug ein langes, schmales, tiefrotes Kleid mit Ranken als Schattenmuster und einem Schlitz bis zur Hüfte. Berenice schien sich jedesmal geehrt zu fühlen, wenn Tain ihr seine Aufmerksamkeit zuwandte. Sie fragte ihn, weshalb er nichts mehr von sich hatte hören lassen.
"Ich konnte nicht", gab er zur Antwort. "Keine Zeit."
"Du siehst so verändert aus", bemerkte Berenice. "Mit dir stimmt etwas nicht."
Tain erzählte ihr von dem Androiden, der ihn verfolgte und von den Versuchen, die im Institut in SalaRien mit ihm durchgeführt wurden.
"Das ist doch Unsinn", meinte Berenice. "Du hast schon zuviel intus für heute."
"Ich gehöre zu der Einheit in Stellwerk", wollte Tain ihr den Sachverhalt erklären. "Da gelten eigene Regeln. Sie können mit mir machen, was sie wollen."
"Und warum haben sie dich hierher gehen lassen?"
"Das ist Willkür. So etwas tun sie manchmal. Und dann kommen sie wieder an, und ich soll alles mitmachen, was sie von mir verlangen."
"Und das können die einfach so?" wunderte sich Berenice. "Kann dich da keiner wegholen?"
"Das geht nicht. Die haben alles abgesichert. Ich bin denen ausgeliefert."
"Hast du dich nicht erkundigt, was du tun kannst?"
"Was glaubst du, was Staale für eine Macht hat ... was der zu sagen hat ..."
"Ist keiner mehr über ihm?"
"Doch - der Tod ist noch über ihm."
"Willst du dich etwa umbringen?" fragte Berenice erschrocken.
"Was weiß ich ...", erwiderte Tain achselzuckend. "Im Augenblick habe ich dazu keine Lust."
Als der Morgen nahte, nahm Tain die besorgte Berenice und fünf weitere Bekannte mit zu sich nach Hause. Kerzen und Rauchwerk wurden angezündet, Kaffee wurde gekocht und Hochprozentiges hineingegossen. Berenice setzte sich bei Tain auf den Schoß.
"Paß' auf meine Frisur auf", ermahnte sie ihn. "Da sind Ziernadeln drin."
Wie von selbst rutschte der Schlitz ihres schimmernden Kleides auseinander, und die tiefroten halterlosen Strümpfe mit dem Spitzenrand wurden in ihrer ganzen Länge sichtbar. Einer von Berenices Pumps fiel auf die schwarz lasierten Dielenbretter.
Als Tain von Berenices Beinen aufblickte, stand Sel Veey im Zimmer. Tain fühlte sich innerlich erstarren und wollte verhindern, daß es den anderen auffiel. Er hatte nicht den Eindruck, daß die Gäste über Sels Ankunft erstaunt waren. Sie kannten Sel nicht und verwechselten ihn offenbar mit einem menschlichen Wesen.
"Sel, da drüben sind noch Stühle", sagte Tain so einladend wie möglich. "Ich bin leider ... ich kann im Augenblick schlecht aufstehen und dir einen Stuhl holen."
Sel nickte und stellte sich mit seinem Telefon in den Flur.
"Wer ist das?" wurde Berenice mißtrauisch. "Tain, hattest du vorhin nicht gesagt, in SalaRien gibt es einen Androiden, der 'Sel' heißt?"
"Ja, aber ... der bleibt hier nicht lange, da sorge ich schon für", versprach Tain.
Die Runde sang Trinklieder und tauschte Drogen und zweifelhafte Witze aus. Vor allem Tain gab sich Mühe, für Heiterkeit zu sorgen. Er wollte auch Sel einbinden.
"Du lachst nicht, du trinkst nichts, du nimmst nichts", wandte er sich an Sel. "Ist das nicht furchtbar langweilig?"
Sel schüttelte den Kopf.
"Kannst du singen?" fragte Tain. "Dann sing' mit uns."
"Das ist nicht meine Aufgabe."
Tain bekam eine Nachricht auf sein Telefon. Er setzte Berenice auf seinen Stuhl und ging in eine Nische, wo er die Nachricht las. Sie war von Leen und lautete:
"Sel nimmt dich gleich mit, wenn die Gäste weg sind."
Es gelang Tain, den frühmorgendlichen Kaffeeklatsch noch für eine gute Weile auszudehnen. Am Schluß war nur noch Berenice da, und die schien ihrerseits darauf zu warten, daß Sel sich verabschiedete.
"Tain, laß' uns gehen", meldete sich Sel und erhob sich von seinem Drahtstuhl. "Es wird Zeit."
Tain verhielt sich so, als hätte er nichts gehört.
"Vielleicht wird hier gleich noch jemand erscheinen", sagte Sel zu Berenice, "und es wird vielleicht eine sehr belastende Auseinandersetzung geben."
"Hast du noch jemanden eingeladen?" erkundigte sich Berenice. "Irgendwen, den Tain nicht sehen will?"
Sel nickte.
"Laßt ihn doch endlich in Ruhe", sagte Berenice aufgebracht. "Das geht euch doch gar nichts an, was mit Tain ist. Das muß er doch selbst wissen. Wenn er etwas von euch will, kann er immer noch ankommen und darum bitten."
"Wenn es soweit ist, solltest du nicht mehr hier sein."
"Tain entscheidet, ob ich hierbleibe oder nicht, das ist immerhin seine Wohnung."
"Es ist rechtens", entgegnete Sel, "was wir hier tun, das geht über die Leitung von Stellwerk, und wir dürfen es nicht nur, wir müssen es sogar. Es ist eine Anordnung."
"Anordnung ... ihr dürft euch an Tain ruhig vergreifen, denn ihr habt eure Anordnung ..."
"Tain, wie sieht es aus?" fragte Sel.
"Ihr macht ihn kaputt", urteilte Berenice. "Tain hat fast keinen eigenen Willen mehr, so weit habt ihr ihn schon gebracht. Es ist doch besser, als Mensch zu sterben, als weiterzuleben als seelenlose Maschine."
"Wie kommst du zu dieser Ansicht?"
"Ich habe Tain vorher gekannt, als er noch nicht in diesem Institut eingesperrt war. Und ich sehe ihn jetzt. Und das sagt mir genug. Entweder ihr formt ihn noch völlig um, oder ihr treibt ihn in den Selbstmord."
"Die Hintergründe kann ich dir nicht erklären", entschuldigte sich Sel, "und ich darf es auch nicht. Ich nehme also hin, daß du diese Meinung hast."
"Du machst es dir leicht", sagte Berenice vorwurfsvoll. "Das ist schön, wenn man es sich so leicht machen kann. Ich sollte bald hoffen, daß Tain den Mut hat, von der Brücke zu springen. Immer noch besser so, als daß ihr weiter mit ihm macht, was ihr wollt."
Sel begann, die Wohnung aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es war, als Tain am Vortag hierher zurückkehrte. Berenice ging auf und ab und rauchte. Tain war im Schlafzimmer verschwunden.
Rega erschien, noch ehe es hell wurde. Ein Kollege namens Les begleitete ihn. Sel öffnete den beiden die Tür. Berenice stand im Flur und schien etwas sagen zu wollen. Rega reichte ihr freundlich ihren Mantel und schickte sie hinaus.
"Kennt sie dich?" erkundigte sich Sel.
"Von früher", antwortete Rega, "ich glaube, sie wollte mal was von mir."
Im Schlafzimmer stand Tain vor der gläsernen Außenwand. Das Licht war nicht an. Hinter dem weiten Strebengitter lag der Abhang im Nebel.
"Hier ist alles aufgeräumt", berichtete Sel. "Du kannst jetzt gleich mitkommen."
"Und ihr werdet mich nicht mehr hierher kommen lassen", griff Tain vor.
"Das hängt von dir ab", entgegnete Sel und reichte ihm die Hand.
Tain wollte die kühle, umpolsterte Stahlklaue nicht nehmen.
"Kann Berenice zu mir ins Institut in SalaRien kommen?" erkundigte er sich.
"Nein."
"Und warum nicht?"
"Das Institut gehört zu einer Sicherheitszone, ebenso wie die Anlage in Stellwerk. Unter anderem gelten dort bestimmte Datenschutzrichtlinien."
"Telefonieren kann ich aber."
"Das kannst du immer."
Rega und Les stellten sich vor Tain.
"Kommst du mit?" fragte Sel.
Tain folgte Rega und Les ohne einen Laut. Er dachte an die Schienenstränge unter der Brücke.
- - -
Im Flur des Instituts in SalaRien kam Leen ihnen entgegen.
"Du bist immer ganz viele", sagte Tain zu ihm. "Sie alle sind deine verlängerten Arme. Alle tun, was du willst, sogar Staale."
"Und du?"
"Was ich heute Nacht alles genommen habe, wirst du nicht erfahren."
"Es ist schon in Ordnung."
"Bringt dich nichts aus der Fassung?"
"Doch, schon, aber mit Drogen hat das nichts zu tun."
"Und was, bitte?"
"Das erzähle ich dir nachher gerne."
"Tain, kommst du mit?" fragte Sel.
Durch die geöffnete Schiebetür fiel helles Licht.
"Rega, Les, ich will von euch eine Meinung hören", wandte Tain sich an die beiden. "Wie findet ihr das, was ihr hier tun sollt?"
"Das hat im Grunde Leen alles erklärt", antwortete Rega.
Tain herrschte Rega an:
"Wenn ich nicht wüßte, daß Leen dich auch beeinflußt hat, dann würde ich noch mehr enttäuscht sein von dir, nein ... entsetzt wäre ich, weil du dich dafür hergibst."
Rega und Les kamen schweigend näher.
"Sobald ich kann, vernichte ich mich selbst, dann können mir die anderen nichts mehr tun", dachte Tain.
- - -
Morgens kam Leen zu Tain an den Rechner, der mit Lanwer verbunden war.
"Wie du weißt, gibt es eine Bahnlinie, die SalaRien mit dem interstellaren Hafen von Stellwerk verbindet", sagte Leen. "Du kannst auf diese Weise von hier aus täglich dorthin fahren und in der Zentrale arbeiten."
"Was soll ich denn den Leuten da erzählen?"
"Vielleicht - die Wahrheit?"
"Die fragen mich, warum ich nicht längst in Lanwer bin."
"Dafür hast du doch Gründe?"
"Und ich soll an jedem Abend wieder hierher kommen."
"An jedem Abend."
"Und wenn ich nicht komme?"
"Das ist deine Entscheidung."
"Ihr sucht mich nicht."
"Doch, wir suchen dich."
"Und wenn ihr mich gefunden habt?"
"So bald, wie es geht, sollst du zurückkehren in deine Wohnung, und wir sehen zu, daß du nach Lanwer kannst."
- - -
Tain stand am Ende der mit Rauhreif bedeckten Plattform. Die Eiskristalle auf den Betonsteinen glitzerten im roten Licht der Abenddämmerung.
"Und wenn ich ...", dachte er mit einem Blick auf die Schienen.
Er warf seine Zigarette hinunter. Ein silbergrauer Zug rauschte heran, und die Schiebetüren sprangen auf. Die Wärme des Innenraums schlug Tain entgegen. Er beschloß, nur deshalb einzusteigen, weil ihm kalt geworden war.
"Ich kann nicht immer nur aufgeben", dachte er. "Ich kann Leen nicht immer gewinnen lassen. Einmal muß er sich verrechnen."
- - -
Tain machte kein Licht im Treppenhaus; er wollte verhindern, daß die anderen ihn gleich entdeckten. Durch die endlos hohe Wand aus Glasbausteinen glitzerten die Straßenlaternen. Die Stufen lagen im Schatten; Tain hielt sich am Geländer und tastete sich hinauf. Bleich und schemenhaft standen die Ziffern an den Türen zu den einzelnen Stockwerken.

Tain erinnerte sich an etwas, das so ähnlich aussah wie dieses dunkle Treppenhaus. Es war ein dunkles Zimmer gewesen; er sah das Gittermuster der Stores vor sich, dessen Schatten vom Licht der Straßenlaterne an die Wand geworfen wurde. Das Zimmer war still gewesen, schlafend; man sah nur eine leise Bewegung des Schattenmusters durch den Wind, denn das Fenster war gekippt. Die wenigen Möbel waren heile und ruhig, die Oberflächen glänzten. Es war eine einfache und eigentlich bedeutungslose Erinnerung. Dennoch löste sich Tains Beklemmung auf in einem ungekannten Gefühl der Trauer. Tain konnte dieses Gefühl nicht zuordnen; er verstand nicht, um was er trauern sollte. Er wollte das Gefühl vergessen, aber es kam nicht nah genug an ihn heran, um erfaßt und weggelegt werden zu können.
Die Trauer machte angreifbar und verletzbar. Tain wollte einerseits rasch aus dem Treppenhaus mit seiner schwer lastenden Dunkelheit herauskommen, andererseits gab ihm die Dunkelheit Schutz vor Blicken und Angriffen.
Tain konnte nicht in sein Zimmer gehen, ohne jemanden um den Schlüssel zu bitten. Er ging also in eine Sitzecke im Flur, wo kein Licht brannte. Leen fand ihn reglos dasitzend, mit verschränkten Armen. Er setzte sich schweigend ihm gegenüber.
"Du wirst sie holen, nicht wahr?" fragte Tain nach einer Weile.
"Ich möchte sie erst holen, wenn du mich darum bittest", antwortete Leen.
"Und wenn ich dich nie bitte?" fragte Tain. "Wie lange wirst du warten?"
"Kannst du mir erzählen, was in dir vorgeht?"
"Ich weiß nicht, was das ist."
Die Leere war nicht mehr da. Das Gefühl der Trauer nahm Tain ganz für sich in Anspruch und schien auch noch über ihn hinauszureichen.
Als Sel kam und Tain bat, mit ihm zu kommen, konnte Tain nichts erwidern und folgte ihm wortlos.
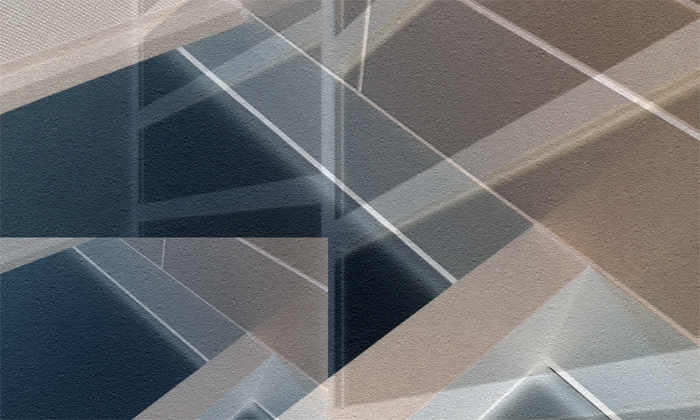
"Und nun ...", sagte Sel in dem Raum mit den Milchglasscheiben.
Tain schüttelte den Kopf. Er war sich bewußt, daß Sel als Maschine über eine niemals endende Geduld verfügte. Er war sich auch bewußt, daß er selbst es nicht mehr lange aushalten würde, und es gab noch immer keinen Stuhl in dem Raum.
"Ich rauche eine", sagte Tain. "Soll ich 'rausgehen dazu?"
"Nein", kam es von Sel.
"Ich muß jetzt eine rauchen ... ich habe die Zigaretten hier nicht, ich gehe und hole sie."
"Nein."
"Ich brauche jetzt eine."
Léry und Seera erschienen.
"Hast du Zigaretten?" wandte Tain sich an Léry.
Léry antwortete nicht.
"Was ist, bist du jetzt auch stumm, wie Seera?" fragte Tain kühl.
Léry hob die Schultern.
"Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt", zeigte Tain Unverständnis. "Ihr verschwendet eure Zeit mit mir. Ich soll das, was ihr macht, noch selbst mitmachen. Und das werde ich nie tun, das wißt ihr so gut wie ich. Ihr könnt also nur mich zwingen und sonst nichts. Worauf wartet ihr also?"
Es kehrte Stille ein. Man hörte das Summen von Apparaten hinter silbrigen Schrankfronten. Die Anzeigelämpchen bildeten ein Muster aus unterschiedlich langen Linien. Tain sah jede Einzelheit mit wachen Sinnen, klar und fast überwirklich.
Tain wich Sel aus. Sel folgte Tain gleichmäßig und langsam. Tain fühlte sich erschöpft und sehnte sich danach, stehenzubleiben. Er lief schließlich zur Tür und drängte Leen beiseite, der davorstand. Sel legte von hinten beide Arme um Tain, so daß er nicht mehr fortkonnte. Tain wollte sich befreien, aber jeder Versuch zersprang wie Glas in viele Scherben. Er holte tief Atem, wieder und wieder, aber es ging nicht genug Luft hinein.
"Man kann nicht alles auf einmal schaffen", meinte Leen. "Es genügt für heute."
Wie einen Schauer empfand Tain die Hoffnung, daß Sel nun von ihm ablassen würde.
"Ich gebe dir etwas", sagte Leen. "Es geht sonst einfach nicht. Sel bringt dich zu dem Tisch."
Tain fühlte seinen Körper wie einen wehrlosen Gegenstand, etwas Fremdes, von dem er sich doch nicht entfernen konnte. Tain wollte die Bindung an sich selbst lösen, ohne in sich zurückzukehren.
- - -
Sel stieg mit Tain die Eisenbahnbrücke hinauf. Es war eine Stahlkonstruktion, Teil einer Industrieanlage. In der Ferne verzweigten sich die Gleise, auf dem Weg zum Raumflughafen. Das Metall schimmerte blaß. Weiter hinten versank es im Nebel.
"Sieh dir die Züge an", bat Sel. "Und höre sie."
Es zischte in den Schienensträngen, wenn sich ein Zug näherte. Die Züge glänzten silbern. Sie waren leicht und schnell.
"Wie ist das für dich?" fragte Sel Veey.
"Ich denke an den Hafen", sagte Tain. "Ich denke, daß sie zum Hafen fahren, wo ich auch hinwill."
"Du denkst an L /. 7?"
"Ich will nach L /. 7. Aber manchmal kommt es mir so sinnlos vor, als wenn ich gar nicht weiß, was ich dort soll."
"Was suchst du denn?"
"Die Auflösung."
"In was?"
"Ich will, daß ich nicht mehr bin, so wie ich bin. Ich will zerfallen und dann endlich Ruhe haben."
"Was hat dich bisher davon abgehalten, dich auf die Gleise fallenzulassen?"
"Ich bringe es nicht über mich; dabei will ich es doch eigentlich."
"Bist du wütend auf dich, weil du es noch nicht getan hast?"
"In gewisser Weise, ja."
"Willst du jetzt über das Geländer steigen?"
"Das läßt du zu?"
"Ich stehe hier. Ich halte dich."
"Und wenn wir nach drinnen kommen, ist ... das wieder."
Sel nickte.
"Ich will irgendwo hin", sagte Tain, "aber ich weiß nicht, wohin. Eigentlich gibt es gar nichts mehr, was ich will. Das ist alles weg."
"Was müßte geschehen, damit es für dich Sinn hat, zu leben?"
"Es müßte etwas da sein, statt dieser Leere."
Tain blickte in Sels regungsloses Gesicht, und eine Ahnung stieg in ihm auf.
"Deine Augen sind Kameras?" wollte er wissen.
Sel nickte.
"Kann jemand durch dich sprechen und deine Bewegungen steuern, ohne selbst anwesend zu sein?" fragte Tain weiter.
Sel bestätigte auch dies.
"Und Leen steuert alles", folgerte Tain. "Er weiß nicht nur, was hier geschieht, sondern hat auch teil daran."
"Er hat teil daran."
"Leen beobachtet mich immer, er hat immer zu tun. Der fällt nie in dieses Nichts."
"Hast du nicht auch zu tun?"
"Doch, aber das hält mich nicht."
"Und was hält Leen?"
"Das weißt du doch besser, dann sag' es mir."
"Leen will etwas herausfinden."
"Und was?"
"Er will etwas Unsichtbares sichtbar machen."
"Und was?"
"Etwas ist da, das kann man nicht anfassen."
"Was denn?"
"Das Nichts ist kein Nichts. In dem Nichts ist etwas."
"In mir ist nichts."
"Das stimmt nicht, Tain."
"Woher willst du das denn wissen?"
"Du glaubst es mir erst, wenn du es selbst wahrnimmst."
"Sel ... du mußt nie atmen?"
"Nein."
In der Luft hing der Geruch von Staub, Rost und Nässe. Tain begann zu frieren.
"So riecht der Tod", dachte er. "So ist es wirklich. So kalt habe ich es mir nicht vorgestellt."
Er zitterte in seinem Mantel und stieg langsam wieder von der Brücke hinunter.
Auf einem Nebengleis war ein Waggon abgestellt worden, den ein Unfall verwüstet hatte. Tain blieb nachdenklich stehen.
"Die Wagen davor und dahinter sind alle heile", sagte er, "nur der eine ..."
"Wie würdest du den beschreiben?"
"Zerrissen. Das Innere nach außen gekehrt. Da sollte man sich eigentlich hineinsetzen können, dafür war das gedacht, und jetzt ist es so kaputt, daß man es nur noch wegwerfen kann."
"Das macht der Tod auch mit uns, wenn wir von einer Brücke stürzen."
- - -
"Wo willst du hin?" fragte Sel, als sie zur Eingangstür gekommen waren.
Tain schaute hinunter in eine Durchfahrt für Lastfahrzeuge, die sich neben der Außentreppe befand. Er hatte sich an etwas erinnert und wußte nicht, ob es wirklich so geschehen war.
Es war in Raum beta/b gewesen, der eher einem Flur ähnelte als einem Zimmer. Von der Decke fiel nebliges weißes Licht auf ein Aluminiumgestell. Tain hatte etwas sagen wollen; er sah aber die Worte nur vor sich, ohne sie aussprechen zu können. Ein Stück entfernt hörte er Leen telefonieren, und er konnte einige Sätze verstehen:
"Davon haben wir noch etwas im Lager, und das reicht auch noch bis SalaRien. Dann machen wir erstmal so weiter. Danke für deinen Rat. Ich rufe dich wieder an, Rikka."
Sel hatte dicht bei Tain gestanden. Tain fühlte sich selbst nicht, es gab nur etwas, das ihn beunruhigte und daß er nicht beschreiben und sich auch nicht merken konnte. Er wollte Sel darauf hinweisen, ihm wenigstens Zeichen geben.
In dieser Erinnerung gefangen, zog Tain sein Telefon hervor und rief Leen an.
"Leen?"
"Ja?"
"In der Fähre ... in Raum beta/b ... habe ich da etwas getan, das ich nicht hätte tun dürfen?"
"Was hättest du denn nicht tun dürfen?"
"Mich selbst verraten."
"Tain, ich glaube nicht, daß du dich selbst verraten hast."
"Und wenn, was würdest du an meiner Stelle tun?"
"Wie soll man sich denn deiner Ansicht nach selbst verraten?"
Tain beendete das Gespräch.
In dem Raum mit den Milchglasscheiben stand Tain reglos da und versuchte, seine Erinnerungen abzuwehren. Er hatte die Hände auf graues Kunststoffgewebe gestützt. So grau waren die Wände in Raum beta/b gewesen.
Ihm fiel ein, daß das Fehlen von Worten und Erinnerungen unschuldig machte. Die Leere in seinem Innern war vielleicht auch ein Schutz davor, noch mehr zu wissen und sich noch schuldiger zu fühlen.
"Du kannst die Erinnerungen ablegen", sagte Leen, "wenn du für alles, was dich belastet, ein Fach oder eine Kammer einrichtest."
"Was willst du mir eigentlich beibringen?" erwiderte Tain. "Du bist doch sogar noch ein Jahr jünger als ich."
"Das stimmt."
"Da hast du mir doch gar nichts zu sagen."
"Wovon hängt das denn ab, was wer zu wem sagen darf?"
"Von der Lebenserfahrung. Und davon hast du weniger als ich."
"Wer hat dir denn etwas zu sagen?"
"Mein Vater hatte mir mal früher etwas zu sagen, aber jetzt auch nicht mehr. Und mein Vorgesetzter ..."
"Staale."
"Nach dem, was hier abgelaufen ist, weiß ich auch nicht mehr, was ich von ihm denken soll ... und was ich von meinem Beschäftigungsverhältnis denken soll."
"Dein Beschäftigungsverhältnis hat sich nicht geändert."
"Hat er das hier nicht alles angeordnet?"
"Das ist richtig."
"Und er hat angeordnet, daß du über mich entscheiden sollst."
"Ja."
"Staale tut doch sowieso alles, was du willst", behauptete Tain. "Du hast ihn doch in der Hand."
"Staale tut nicht immer, was ich will."
"Was willst du denn?"
"Ich will ...", begann Leen.
"Hör' auf, hör' auf", unterbrach ihn Tain. "Hör' auf zu reden. Das ist unerträglich, wie du immer dasselbe erzählst. Du redest dich immer nur heraus. Du redest immer um die Wahrheit herum. Du sagst nie, wie es wirklich ist."
"Wie ist es denn wirklich?"
"So, wie du es gerade nicht sagst."
Sel kam auf Tain zu.
"Schick' ihn weg", verlangte Tain, der mit dem Rücken zum Tisch stand. "Sag' ihm, er soll mich in Ruhe lassen."
- - -
Casyle saß auf einem Fensterbrett im Flur und strickte an einem filigranen geometrischen Muster.
"Was wird denn das?" erkundigte sich Tain.
"Das ist mein Denkmuster über die Schuld", erklärte Casyle. "Ich stricke immer diese Muster, damit ich nie vergesse, daß ich keine Schuld habe an dem, was mir geschehen ist."
"Ist das Tuch in deinem Haar denn auch mit so einem Muster bestickt?"
"Das auch, ja."
"Und du stellst andauernd Muster her."
"Ja, dauernd."
"Und wer hat dir gesagt, daß du das tun sollst?"
"Das habe ich mir selber gesagt. Eines Tages habe ich einen Schal gestrickt mit einem aufwendigen Muster, und ich habe daran gedacht, welche Ordnung ich dort hineinbringe, eine Ordnung, die immer besteht, so lange der Schal besteht. Und eine solche Ordnung will ich in meinen Gedanken auch haben."
"Aber wenn immer du an den Folgen eines Verbrechens arbeitest, bist denn dann nicht du die Gestrafte, statt des Täters?"
"Ich arbeite doch für mich, nicht für den Täter."
Was Casyle widerfahren war, wußte Tain nicht genau. Man erzählte sich, daß sie bei Fremden aufgewachsen war, weil es in ihrem Elternhaus nicht mit rechten Dingen zuging.
Casyle huschte als dienstbarer Geist durch die Gebäude in SalaRien und half immer dort, wo sie gebraucht wurde. Sie schien sich in dieser Rolle gefunden zu haben.
Léry Lassigue hängte vor der Glaswand im Flur Papierbahnen auf, silbrigweiß wie Muschelkalk. Das Papier war bemalt mit waagerechten und senkrechten Linien in Grau und Schwarz, die sich zu Figuren zusammenfügten.
Léry war schwarz und trug asketisch kurzgeschorene Haare. Er hatte einen weiten Anzug mit Stehkragen an, aus grauem Sackleinen, mit schwerer Seide gefüttert. Léry sprach mit seiner nüchternen, kratzigen Stimme einen gleichförmigen Text, den Inir auf einen Zettel geschrieben hatte.
"Ich kann die Worte nicht verstehen", sagte Tain. "Was heißt das?"
"Das sind Gebete für die bedrängte Seele."
"Wessen Seele?"
"Das steht nicht in dem Text."
"Und zu wem betest du?"
"Das steht da auch nicht."
"Und du weißt gar nicht, an wen du glaubst?"
"Gar nicht an wen", erklärte Léry. "An etwas. Und das hat keinen Namen."
"Und keine Gestalt hat es?"
"Keine Gestalt."
"Wie kannst du dir das dann vorstellen?"
"Es ist etwas in mir, wie ein Gefühl, daß da etwas ist, und nichts, was man sich vorstellen kann."
"Wo soll das herkommen?"
"Das war schon da, aber woher, das weiß ich nicht."
- - -
Berenice hatte einen Überwurf aus scharlachroter Seide auf ihrem Bett ausgebreitet. Sie lag neben Tain, die Fernbedienung in der Hand. Er legte die Arme um Berenice und kuschelte sich an sie.
"Berenice", wisperte Tain, "versprichst du mir, daß du immer bei mir bleibst und mich immer beschützt?"
"Ja", antwortete sie. "Wir sind verlobt und müssen immer füreinander da sein."
"Das heißt, du kommst mit, wenn sie mich holen, und paßt auf, daß mich keiner fertigmacht."
"Bist du denn sicher, daß sie dich hier finden?"
"Bestimmt finden sie mich."
"Was mache ich denn, wenn die mich nicht mitgehen lassen?"
"Du schaffst das, daß sie es dir erlauben."
"Und wenn sie dich überwältigen, was kann ich tun?"
"Du wirst einen Weg finden", versicherte Tain. "Ich verlasse mich auf dich."
Er zog den Aschenbecher von einem schwarzen Tischchen und stellte ihn auf den Überwurf, zwischen sich und Berenice.
"Paß' auf mit der Asche", bat sie. "Nicht ins Bett."
Auf dem Monitor am Fußende war eine Uhr zu sehen.
"Ist das jetzt die richtige Uhrzeit?" fragte Tain. "Die Uhrzeit, die wir jetzt gerade haben?"
"Das denke ich schon."
"Ich verstehe nicht, daß das so spät ist."
"Du bist doch gleich nach Feierabend hergekommen."
"Berenice, kannst du mir erklären, warum ich nicht gemerkt habe, daß das schon so spät ist?"
"Du redest machmal so seltsam, und man weiß dann gar nicht, was du meinst."
"Wenn du bei mir bist, kann mir keiner etwas tun."
"Willst du Rotwein trinken?" bot Berenice an. "Das ist ein besonderer Rotwein."
"Hol' ihn, und wirf' mir doch gleich mal das Telefon 'rüber, von da vorne."
Berenice ging in den Keller. Tain wählte die Durchwahl von SalaRien.
"Was gibt es?" fragte Leen.
"Ich will nur wissen, wie das aussieht ...", begann Tain zögernd, "wie gefährlich das ist, wenn ich gar nicht mehr zu euch komme."
"Was das für Folgen hat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen."
"Das heißt, es kann auch sein, daß ich gar nicht in Gefahr bin und euch gar nicht brauche."
"In Gefahr bist du auf jeden Fall", betonte Leen. "Die Frage ist nur, wie schnell es bergab geht."
"Was kann man gegen die Gefahr tun?"
"Am sichersten ist es, wenn wir das weitermachen, was wir bisher getan haben."
"Und das heißt dann, daß ich auf der sicheren Seite bin."
"Um dir zu antworten, müßte ich dir genauer erklären, was wir machen."
"Ach, das laß lieber sein, das stimmt doch sowieso alles nicht."
"Du kannst auch mit Rikka Vaillant sprechen, wenn sie wieder in SalaRien ist."
"Was hat die damit zu tun?"
"Rikka hat entschieden, nach welchem Schema wir vorgehen."
"Ach, ich glaube Rikka auch nicht. Ihr sprecht euch ab und macht aus, was ihr mir erzählt und was nicht. Außerdem war Rikka erst einmal da."
"Nein, mehrmals."
"Mehrmals?"
"Zuletzt vor etwa vierzehn Tagen."
Tain schwieg einen Augenblick und sagte dann:
"Am Ende falle ich doch hinten 'runter."
"Hinten 'runter?"
"Ich habe so Gedanken."
"Was für Gedanken?"
"Daß Staale mich 'rauswirft."
"Wie kommst du denn auf so etwas?" fragte Leen mit Besorgnis in der Stimme. "Wer hat dir denn so etwas eingeredet?"
"Keiner. Ich denke mir nur, daß ich mich doch wirklich nicht so verhalte, wie Staale es von mir erwartet. Und daß er mir das verheimlicht, und er hält mich noch so lange hin, wie er mich braucht, und danach kann ich gehen."
"Was bringt dich denn auf solche Gedanken?"
"Ich kann mir nicht vorstellen, daß Staale das hinnimmt, daß ich so häufig ausfalle und nicht mehr verläßlich das tue, was erwartet wird."
"Wer etwas geben will, hat immer etwas zu geben, so lange er lebt."
"Aber Kosten und Aufwand stehen in keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen."
"Tain, in Stellwerk-SalaRien ist einiges nicht so, wie du es vielleicht von früher gewohnt bist. Es hat sich bewährt, in menschlicher wie wirtschaftlicher Hinsicht, niemanden fallenzulassen."
"Du erzählst Märchen. Ich glaube nicht daran, daß ihr es euch wirklich leisten könnt, auf jeden Einzelnen Rücksicht zu nehmen und auf ihn einzugehen."
"Wir können es uns leisten. Die Rechnung geht auf."
"Nichts dergleichen", erwiderte Tain. "Eines Tages ist es soweit, dann erzählt mir Staale irgendeine Begründung, warum ich gehen soll."
"Wie kommt es, daß du zu Staale so wenig Vertrauen hast?"
"Ich habe ihn doch auch enttäuscht, und das rächt sich."
"Und wenn er dir sagt, du bist ihm sehr wichtig und sollst immer in der Einheit bleiben?"
"Dann schiebt er entweder äußere Gründe vor, die er nicht beeinflussen kann, oder er bekommt einen Nachfolger, und der wirft mich dann 'raus."
"Und du kannst dir nicht vorstellen, daß du für jemand anderen genauso wichtig werden könntest wie für Staale."
"Ich kann mir schon nicht vorstellen, für Staale wichtig zu sein."
"Du bist für Staale wichtig."
"Ich bin für ihn nur zeitweise wichtig und nur in beruflicher Hinsicht."
"Das stimmt nicht."
"Das glaube ich nicht", blieb Tain bei seiner Ansicht. "Du erzählst Märchen."
"Was für Erfahrungen hast du gemacht mit dem Vertrauen?"
"Vertrauen ist sinnlos und gefährlich. Deshalb verlasse ich mich auf nichts und vertraue mich niemandem an."
"Und wie wirst du dir jetzt helfen?"
"Ich komme nicht mehr nach SalaRien", kündigte Tain an. "Mir ist eingefallen, warum Staale mich auf jeden Fall 'rauswirft. Er muß mich 'rauswerfen, weil ich straffällig geworden bin."
"Was soll da gewesen sein?"
"In der Transporteinheit habe ich eine codierte Tür aufgebrochen und eine Tablettenschachtel entwendet."
"Das hat Staale nicht verfolgen lassen."
"Trotzdem, Staale hat dadurch die Handhabe, mir jederzeit fristlos zu kündigen."
"Für die Sache mit den Tabletten wird dich niemand zur Verantwortung ziehen", war Leen überzeugt. "Es ging dir sehr schlecht, und du hattest keine ausreichende Herrschaft mehr über das, was du getan hast."
"Das hast du schon gewußt, als ich das gemacht habe?"
"Wir haben alle gewußt, seit Tagen, daß mit dir etwas nicht gestimmt hat. Wir haben gehofft, daß du von dir aus auf uns zukommst. Wir hätten dich sonst auf jeden Fall angesprochen."
Berenice kam ins Schlafzimmer, in einem schwarzseidenen Negligé. Sie trug zwei Rotweingläser und die entkorkte Flasche. Tain beendete das Telefongespräch:
"Bis dann. Ich habe jetzt erstmal keine Zeit."
"Wer war dran?" erkundigte sich Berenice. "Du wirkst so atemlos."
"SalaRien."
"Du hast die angerufen?"
"Ich glaube, heute kommen sie nicht mehr."
- - -
Das erste verhangene Dämmerlicht zog herauf, als Tain im Zentralgebäude des interstellaren Hafens die Tür zu seinem Arbeitsraum öffnete. Er sah einen weiß blühenden Zweig vor dem Fenster in einer Vase stehen. Mit eiligen Schritten ging er zu seinem Rechner und wollte ihn einschalten.
"Das brauchst du heute nicht", sagte jemand hinter ihm.
Tain stand ruhig da und wartete ab. Er hörte nur seinen eigenen Atem. Sel atmete nicht, und seine Anwesenheit war nicht mehr als die Anwesenheit eines weiteren Rechners. Tain dachte immer daran, als Sel ihm die Hände von der Tischplatte löste und ihn wegführte.
"Es gibt eine Hoffnung", sagte Sel. "Und wir lassen dich nicht fallen."
Tain erinnerte sich an das, was er heute bearbeiten wollte. Es mußte vieles liegenbleiben. Er kam in Verzug, und auch Staale kam in Verzug.
Sel fuhr schweigend mit Tain nach SalaRien. Leen empfing sie im Treppenhaus.
"Nimm am besten zuerst Verbindung zu Lanwer auf", bat er Tain. "Staale hat etwas für dich."
Tain überlegte, welche Begründung Staale wohl dafür angeben würde, daß er sich "von ihm trennen" wollte.
"Ich habe dich nie gefragt, wie es dir hier geht", begann Staale über Monitor und Lautsprecher die Unterhaltung. "Willst du mir dazu etwas sagen?"
Tain antwortete ihm schriftlich:
"Mir fällt nichts ein. Ich will dir etwas sagen, aber ich weiß nicht, was."
"Es geht mir um Folgendes", erklärte Staale, "ich will von dir wissen, ob du bereit wärst, auch weiterhin für uns zu arbeiten."
Tain ließ die Arme sinken und schaute reglos auf den Monitor.
"Du siehst es vielleicht so, daß wir uns schuldig gemacht haben an dir", meinte Staale, "und ich kann das verstehen. Ich will dir das Vertrauen nicht einreden. Was Leen tut, ist nicht geeignet, Vertrauen entstehen zu lassen; im Gegenteil, es wird dein Mißtrauen noch verstärken. Ich will dir nur sagen, daß ich hoffe, daß du bei uns bleiben wirst. Ich werde dich nicht halten können, wenn du gehen willst, aber ich will dir vermitteln, wie wichtig es uns ist, dich weiterhin zur Verfügung zu haben."
"Ich kann gar nicht mehr so", schrieb Tain.
"Du bist immer du selbst", entgegnete Staale. "Und darauf kommt es uns an."
"Das verstehe ich nicht", schrieb Tain.
"Wirst du bei uns bleiben?" fragte Staale.
Tain hatte ein Gefühl, als wenn sein Blut in das Innere seines Körpers zurücksank. Er sah die Umrisse der Tasten vor sich und den Monitor, ein flaches Brett, auf dem Staale ihm gegenübersaß und wartete. Einzelne Wörter erschienen vor seinen Augen, die keinen Zusammenhang bildeten.
"Ich will es jetzt wissen", verlangte Staale schließlich. "Kann es etwa sein, daß du glaubst, wir wollen, daß du gehst?"
Tain konnte immer noch nichts erwidern. Staale betrachtete ihn und schüttelte den Kopf.
"Wir sind froh, daß wir dich noch haben", sagte er leise. "Wir sind dankbar dafür."
Tain stand auf und ging ans Fenster. Er nahm eine mit Meerestieren bedruckte Papierserviette vom Kaffeetablett.
"Das kann keiner fassen", dachte er. "Mich kann keiner erfassen. Mit mir kann man nicht umgehen. Jeder ist mit mir überfordert. Ich kann mich den anderen nicht zumuten."
Leen setzte sich an den Rechner und gab für Staale Textnachrichten ein. Sel Veey blieb in Tains Nähe, rührte sich aber nicht und sagte auch nichts.
"Ich muß hier am Fenster stehenbleiben", wollte Tain sagen, "und ich muß mich abwenden; ich darf euch nicht sehen."
Er hatte den Eindruck, daß die Zeit für ihn anders verging als für seine Umgebung. Er beanspruchte die Zeit von Sel, Leen und Staale in einem Ausmaß, das er nicht überblicken konnte. Er wollte ihnen sagen, sie sollten ihn allein lassen.
Sel gab Tain auch die restlichen Servietten und zog ihn langsam vom Fenster weg. Tain hatte mit den Servietten zu tun und vermochte sich nicht zu wehren. Sel ging mit ihm ins Nebenzimmer, das einem Warteflur ähnelte. Bleiches Tageslicht schien durch eine hohe Fensterwand aus Rauhglas. Einziges Möbelstück in dem kahlen Raum war eine gepolsterte Bank, nebelhaft grau wie der Fußboden. Tain umklammerte das Polster und dachte an die Meereswogen, die immer wieder das Land überschwemmten und niemals versiegten.
"Du hast keine Schuld", sagte Sel. "Es geht hier gar nicht um Schuld."
- - -
"Leen, du siehst angeschlagen aus", bemerkte Staale.
"So sehe ich doch immer aus", erwiderte Leen. "Das hat nichts zu sagen. Außerdem - du siehst mich nur durch den Monitor. Das verfremdet."
"Ich habe dich sehr gedrängt, mit hierher zu kommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das richtig war. Vielleicht übernimmst du dich damit."
"Es ist schon richtig so; ich will es selber."
"Leen, du mußt das nicht weitermachen."
"Ich will Licht in dieses Dunkel bringen."
- - -
Sel schaffte einen Papierkorb herbei und setzte sich neben Tain auf die Bank.
"Was passiert, wenn du draußen ins Gewitter kommst?" erkundigte sich Tain.
"Nichts", antwortete Sel.
"Und das Wasser?" fragte Tain. "Kannst du davon keinen Kurzschluß kriegen?"
"Das geht nicht. Ich habe dir auch beim Duschen geholfen, und es ist nichts passiert."
Tain erinnerte sich daran, daß er sich unlängst noch auf Sel stützen mußte, um ins Bad zu gelangen.
Leen kam in das Nebenzimmer.
"Was kann ich denn eigentlich machen, um von Staale 'rausgeworfen zu werden?" wollte Tain wissen.
"Ein Kollege von dir hat es mal geschafft", erzählte Leen. "Er hat mit Sorgsamkeit und Bedacht eine Intrige gegen Léry ausgesponnen. Léry hat dadurch viel Leid erfahren."
"Welcher Kollege war denn intrigant?"
"Marvel."
"Marvel? Nicht etwa DJ Marvel aus dem 'Ruin'?"
"Doch, der legt seit damals im 'Ruin' auf und verdient dort viel Geld."
"Den habe ich doch kürzlich erst gesehen", erinnerte sich Tain. "Er wirkte so unbeschwert, als wenn ihm das alles gar nicht zu schaffen gemacht hat."
"Marvel hat auch gegen Staale intrigiert, aber das ist erst herausgekommen, nachdem Staale ihn vor die Tür gesetzt hat."
"Intrigiert Marvel im 'Ruin' jetzt nicht weiter?"
"Vielleicht wissen die das noch nicht, aber sie werden schon merken, daß Marvel intrigant ist. Niedertracht bleibt nicht auf ewig verborgen."
"Kann sein, daß sie mit ihm viel Gewinn machen und das in Kauf nehmen."
"Für immer geht das auch nicht."
"Was hatte Marvel eigentlich gegen Léry?"
"Léry hat Inir."
"Leen, glaubst du, Staale wirft mich 'raus, wenn ich dich umbringe?"
"Glaubst du denn, daß er es tun würde?"
"Eigentlich muß er es doch tun."
"Wie würdest du mich denn gerne umbringen?"
"Das habe ich doch nicht gesagt, daß ich wirklich vorhabe, dich umzubringen."
- - -
Tain saß in seinem Zimmer in SalaRien auf dem Bett und blickte nach draußen. Er trug weite graue Sachen aus einem knisternden Material, die er vor zwei Tagen in Birkwald gekauft hatte. Er war unschlüssig, ob er sich mit Berenice verabreden sollte oder mit der sehr jungen Neueroberung Mauralea, die er aus einem Forum kannte. Berenice ahnte von Mauralea nichts, weil die beiden unterschiedliche Bekanntenkreise und Arbeitsstellen hatten und weil Berenice kein Mitglied in dem Forum war. Ihrerseits wußte Mauralea nichts von Berenice. Tain achtete darauf, daß Mauralea überzeugt war, die "Einzige" und "Auserwählte" zu sein.
"Ich habe jetzt keine Zeit", sagte Tain, als Leen vor ihm stand.
"Komm' mit uns mit", bat Leen.
"Ich habe keine Zeit", wehrte Tain ab. "Das habe ich dir doch schon gesagt."
"Komm' mit uns mit."
"Du verstehst wohl auch nicht, was man zu dir sagt."
Sel, Rega und Léry waren ins Zimmer gekommen. Tain fühlte sich von ihnen gepackt und entschloß sich, sie dieses Mal nicht gewinnen zu lassen.
"Ich muß telefonieren", rief er. "Ich habe ein wichtiges Gespräch."
Auf einen Wink von Leen ließen sie von ihm ab. Leen stellte sich wieder vor Tain und fragte:
"Sollen wir kurz nach draußen gehen, damit du telefonieren kannst?"
"Egal, ich komme sowieso nicht mit, ihr wartet umsonst."
"Tain, ich bitte dich", sagte Leen eindringlich, "es muß nicht immer so ablaufen."
"Du hast alles getan, um mein Vertrauen in dich zu zerstören", erwiderte Tain. "Ich warte nur auf den Tag, an dem ich dich nicht mehr sehen muß."
"Der wird bald kommen."
"Was soll das heißen?"
"Das heißt, daß du mir bald nicht mehr begegnen wirst."
"Und weshalb nicht?"
"Ich werde nicht mehr da sein."
"Wo gehst du denn hin?" erkundigte sich Tain.
"Das weiß ich nicht", gab Leen zur Antwort. "Ich weiß nur, daß es bald soweit ist."
"Ach ... wieso, du hattest doch gesagt, du hast noch fünf Jahre."
"Es könnten weniger sein."
"Wieviele weniger?"
"Das weiß ich nicht."
"Was wird aus Sel, wenn du nicht mehr da bist?" wollte Tain wissen. "Wie ist er dann?"
"Das hängt davon ab, wie er programmiert ist und wer ihn steuert."
"Das ist dann vielleicht gar nicht mehr Sel, wie ich ihn kenne?"
"Sel ist ein Gegenstand. Er hat kein eigenes Ich."
"Und woher kommt das, was er sagt?"
"Nicht von ihm."
"Von dir?"
"Auch von mir."
"Und von wem noch?"
"Er hat eine Basissoftware, die ist vorinstalliert."
"Und ich soll einer Maschine vertrauen."
"Es geht nicht um die Maschine."
- - -
Es taute. Am Nordwall spiegelte sich in den Pfützen eine lange Reihe dunkelroter Backsteinhäuser, die sah aus wie eine einzige Mauer, durchbrochen von Stahltüren und Treppenhausfenstern. Streugut lag auf dem Gehweg. Unter den Kanalgittern rauschte das Wasser. Sonst konnte Tain in der Stille nichts hören außer seinen Schritten auf dem Pflaster. Die Hauswände wirkten stumpf in dem fahlgrauen Tageslicht. Tain wollte nach etwas greifen, nach etwas rufen; er wußte aber nicht, wonach er hätte rufen sollen. In den Wasserfluten sah er sein Spiegelbild. Es wirkte fremd auf ihn.
"Soll das alles sein?" dachte er. "Ist es das, was wir sind?"
In Haus 14 wartete Berenice auf ihn. Tain stellte sich vor, daß er in ihre Wohnung kam, und alles sah anders aus, nur ein großer, leerer Saal war da mit einem steinernen Fußboden, und hinter den Fenstern war eine Weite, ein Blick in die endlose Ferne, und etwas war da, etwas Unbestimmtes, das ihn kannte, aber das er nicht kannte. Er hatte keine Herrschaft darüber, es hatte aber Herrschaft über ihn.
"Will ich das?" fragte er sich. "Will ich, daß etwas Herrschaft über mich hat?"
Ihm kam ein Gedanke:
"Vielleicht ist es Leen doch gelungen, mich zu brechen ... auf eine ganz hinterhältige Weise. Er hat mich immer wieder vergiftet, und das Gift hat mich verändert, so daß ich jetzt etwas vermisse, das ich früher nie gebraucht habe. Leen hat mich abhängig gemacht. Ich sollte ihn meiden, wo es nur geht, vielleicht hört es dann irgendwann wieder auf."
Tain fühlte sich seltsam verloren, seltsam allein, sogar in Berenices Armen. Auf seine Bitte umschlang sie ihn so fest, wie sie nur konnte, das half aber nichts.
- - -
"Tain!" rief Berenice vom Schlafzimmer aus. "Kommst du endlich?"
"Gleich."
"Was machst du da noch in der Küche?"
"Ich will nachgucken, ob du wirklich keine Zigaretten mehr hast."
"Hier neben dem Bett liegt eine halbe Schachtel, da kommst du doch erstmal mit hin?"
"Bis zum Morgen vielleicht, also ..."
Tain setzte sich auf die Bettkante und griff nach Berenices Zigaretten.
"Und was mache ich dann, wenn du die alle aufrauchst?" fragte sie. "Ich gebe dir immer welche und kriege sie nicht zurück."
"Das ändert sich sowieso bald."
"Was ändert sich?"
"Übermorgen gehe ich nach Lanwer. Staale hat gesagt, daß er mich dort braucht."
"Ach, und deshalb willst du mich verlassen?" fragte Berenice und richtete sich auf.
"Wieso verlassen?" erwiderte Tain schulterzuckend. "Ich gehe nach L /. 7, aus beruflichen Gründen; das ist alles."
"Und wann kommst du wieder?"
"Wenn wir mit der Studie fertig sind, die wir in Lanwer machen."
"Und wann soll das sein?"
"Das ist noch nicht heraus."
"Soll ich nicht besser mitkommen?"
"Berenice, du hast doch hier alles, deine Arbeit, deine Wohnung, deine Freunde."
"Wenn du nicht hier bist, bringt mir das auch nichts mehr."
"Sei doch vernünftig. Das ist nicht gut für dich, wenn du mitkommst."
"Ich hab's - du willst nicht, daß ich mitkomme."
"Das habe ich nicht gesagt."
"Nein, gib' es zu - du willst verhindern, daß ich mitkomme."
"Das will ich nicht."
"Dann laß' mich auch mit dir gehen."
"Berenice, wie stellst du dir das denn vor?"
"Es wird doch auf L /. 7 auch eine Möglichkeit für mich geben, Geld zu verdienen. Und die Wohnung kann ich aufgeben; wir wollten doch sowieso zusammenziehen."
Tain stockte und schien nicht zu wissen, was er erwidern sollte.
"Du willst doch, daß wir zusammenziehen?" forschte Berenice.
Tain zündete sich eine Zigarette an.
"Jetzt sag' was", verlangte Berenice. "Du liebst mich nicht mehr, ist es so?"
"Ich liebe dich", beteuerte Tain und küßte ihre tiefrot geschminkten Lippen, "mehr, als ich jemals eine Frau geliebt habe. Ich bin noch keiner Frau begegnet, die so schön und verführerisch ist wie Berenice Alder."
"Und warum gehst du dann von mir weg?"
"Ich sagte dir doch, es kann immer sein, daß man für eine Zeitlang getrennt ist."
"Was ist dir eigentlich wichtiger?" fragte Berenice. "Ich oder diese Leute, die dich den ganzen Winter lang eingesperrt und gequält haben?"
"Mir geht es nicht um die Leute, sondern um das, was ich in Lanwer beruflich erreichen kann."
"Und das Berufliche ist dir wichtiger als ich."
"Berenice, Schatz, ich sage doch nicht, daß mir eines wichtiger ist als das andere", wurde Tain ungeduldig. "Nur steht im Augenblick das Berufliche mal im Vordergrund. Diese Chance kann ich nicht vertun."
"Und wie lange willst du in Lanwer bleiben?"
"Das kann ich noch nicht absehen, wie lange so etwas dauert."
"Ach, und auf was soll ich mich dann einstellen?"
"Ich sagte ja, das weiß ich nicht."
"Ach, und du hast wohl keine Sehnsucht nach mir."
"Doch, natürlich habe ich Sehnsucht nach dir."
"Dann könntest du doch deinen Aufenthalt in Lanwer mal unterbrechen, um mich zu besuchen."
"Das geht nicht so einfach, mal so eben von Lanwer nach Stellwerk. Das sind andere Verhältnisse, als wenn du mit dem Zug von Birkwald nach SalaRien fährst."
"Ich sage ja auch nicht, daß wir uns jeden Tag treffen müssen", verhandelte Berenice. "Ich rede nur davon, daß wir uns vielleicht doch ab und zu mal sehen sollten."
"Versprechen kann ich das nicht. Ich weiß nicht, wie der Ablauf in Lanwer sein wird."
"Kann ich dich denn anrufen?"
"Es gibt eine Verbindung über den Rechner, sicher. Allerdings brauchst du dann einen Zugriffscode ..."
"Ach."
"... und den bekommen nur autorisierte Mitarbeiter von der Zentrale in Stellwerk-Hafen. Ich kann dich aber anrufen, über deinen Rechner."
"Ich glaube, dir ist das gar nicht wichtig, mich zu erreichen."
"Warum soll mir das nicht wichtig sein?"
"Wenn dir das wichtig wäre, würdest du mir den Zugriffscode geben."
"Das kann doch ich nicht entscheiden. Das ist Datenschutz."
"Ich verstehe immer noch nicht, weshalb du dich überhaupt noch mit diesen Leuten abgibst, nach allem, was sie dir angetan haben."
"Wenn ich meine beruflichen Ziele erreichen will, komme ich an Staale nicht vorbei."
"Du hängst ganz schön an denen, nicht wahr?"
"Daro Staale und Leen Dayna bedeuten mir überhaupt nichts", sagte Tain mit Nachdruck. "Sie sind mir im schlechtesten Sinne egal. Und mit Rega Mansfeld habe ich auch abgeschlossen. Und Sel Veey ist sowieso gar kein Mensch."
"Dann verrätst du dich doch selber, wenn du mit denen da hingehst."
"Sie dienen mir. Ich kann sie gebrauchen für mein berufliches Vorwärtskommen. Und wenn ich sie eines Tages nicht mehr brauche, gehe ich und überlasse sie sich selbst."
"Und wenn du zurückkommst, können wir dann endlich heiraten?"
"Berenice, ich muß doch erst einmal so weit sein."
"Wann können wir denn nun heiraten?"
"Berenice, du hast mich, du hast mich doch; reicht dir das denn nicht?"
"Andere Frauen haben weniger Hemmungen, wenn du unverheiratet bist", meinte Berenice. "Ich fände es besser, wir würden gleich heiraten, noch ehe du nach L /. 7 gehst."
"Heißt das, wir sollen nur wegen irgendwelcher anderer Frauen heiraten, nicht unseretwegen?"
"Nein, das will ich damit nicht sagen."
"Dann laß' uns doch abwarten, bis die rechte Zeit gekommen ist."
"Es ist für mich einfach sicherer, wenn ich weiß, wir sind verheiratet."
"Was findest du daran 'sicherer'?"
"Es ist unterschrieben und besiegelt, daß wir zueinander gehören."
"Das Vertrauen ist für mich viel wichtiger als der Trauschein", entgegnete Tain. "Der Trauschein ist ein Stück Papier, weiter nichts. Ich kann jeder Frau erzählen, ich bin unverheiratet, auch wenn es nicht stimmt."
- - -
Hinter dunkelgrauen Wolkenbänken leuchtete ein grünblauer Himmel.
"Da ist das Meer", sagte Inir und schaute zu dem silbrigen Streifen in der Ferne hinüber.
Auf einem schmalen Weg aus Holzbrettern lief sie mit Léry durch die Dünen. Rechts waren Pfosten in den Sand gegraben, verbunden mit einem Seil. Am Strand gab es Befestigungen aus Gestrüpp und Beton.
"Auf einer dieser Betonstufen hast du gesessen", erinnerte sich Léry. "Du hast zu keiner Welt mehr gehört, nicht zu der unter Wasser und nicht zu der an Land. Das wäre fast dein Tod gewesen. Deine Stimme hattest du schon verloren."
"Es kann gefährlich sein, zu seinen Träumen zu stehen."
"Wie hat denn Seera seine Stimme verloren?"
"Ihm ist etwas passiert, das ihn sprachlos gemacht hat."
"Ob er seine Stimme wiederfindet?"
"Vielleicht durch einen Zufall", meinte Inir. "Es war ja auch ein Zufall, daß wir uns begegnet sind. Als ich auf der Stufe saß, wolltest du gerade ins Wasser zum Tauchen."
"Und ich habe dieses Kästchen in der Brandung liegen sehen und kam auf den Gedanken, es dir zu geben. Es war mit Türkisen und Smaragden verziert. Einem Mädchen ist es ins Wasser gefallen, als es seiner Gouvernante davongelaufen ist."
"Als ich das Kästchen aufgemacht habe, war darin nichts außer Sand und Salzwasser. Und dann ist die Gouvernante gekommen und hat es abgeholt. Sie hat zu dem Mädchen gesagt, es soll nicht immer mit dem Kästchen spielen, das sei zu wertvoll dafür."
"Und dann bin ich mit dir weggegangen, und der Bann war gebrochen, und du konntest mir erzählen, wie du verflucht worden bist."
"Und das Böse hatte seine Macht verloren. Es war nicht mehr wichtig, es hatte keine Bedeutung mehr."
"Nur durch Sand und Salzwasser wurde der Bann gebrochen."
"Oder war in dem Kästchen noch etwas anderes außer Sand und Salzwasser - etwas, das man nicht sehen konnte?" überlegte Inir. "Ich weiß immer noch nicht, wie ich dem Schicksal dafür danken soll, daß ich hier mit dir durch die Dünen laufen kann. Das ist so wenig und doch so viel - so viel, daß man es nicht beschreiben kann."
- - -
... WEITER ...
... ZUM INHALTSVERZEICHNIS "WIRKLICHKEIT: TEIL 1" ...
... ZUM INHALTSVERZEICHNIS "WIRKLICHKEIT" ...
... ZUM INHALTSVERZEICHNIS "NETVEL" ...
|
|